Jede Woche gibt es in dieser Rubrik eine neue CD, die ich Euch gerne vorstellen möchte! Hier sind die CDs des Jahres 2018:
Für KW 51:  Shuffle - #WontTheyFade? (Klonosphére / Season Of Mist/ Soulfood Music)
Shuffle - #WontTheyFade? (Klonosphére / Season Of Mist/ Soulfood Music)
Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich nicht besonders auf Bands aus Frankreich stehe? Wobei die Abneigung gar nicht mal persönlich gemeint ist… ich kenne nur nicht besonders viele gute französische Bands. So gesehen sind Shuffle sind das Beste, was mir seit Langem von den westlichen Nachbarn in die Hände gefallen ist – und nicht sehr typisch französisch. Mit ihrer Mischung aus Alternative und Progressive Rock, abwechselnd mit Pop, Metal und sogar Rap-Attacken erweitert sind sie soundetechnisch dichter an The Intersphere als jede andere Band... – was aber noch keine wirkliche Nähe ausdrücken muss. Aber sie schaffen es auf diese Weise, sehr spannend und abwechslungsreich zu bleiben. Die Metal-Gitarren werden kontrastiert durch melodische Soundflächen, die Crossover-Parts durch bestechende Hooklines und eingängige Refrains. Cool! Gelungen. Hörenswert!
Für KW 50: The Intersphere - The Grand Delusion (Longbranch/SPV)
 Wow,
5 Jahre haben sie sich Zeit gelassen. Das ist für die Mannheimer
Jungs, die mit 4 Alben in 5 Jahren gestartet waren, eine verdammt lange
Pause. Und in der Tat haben sie ein paar Dinge umgestellt. Das begann
schon mit der Art zu komponieren in Jam-Manier, statt sich auf durch
Sänger Christoph Hessler vorbereitete Songs zu verlassen, und
setzt sich fort in den ersten vier Songs des Albums. „Think
Twice“ beginnt extrem eingängig, „Man on the
Moon“ wartet gar mit einem Soul-Touch auf und
„Overflow“ mit Uh-Uhs (oder schreibt man
„Ooh-Oohs“?, Immerhin singen sie ja englisch…). Aber
keine Angst, das Ganze mehr oder weniger im Rahmen des
Intersphere-typischen Rock-Universums. Und mit Abwechslung habe sie ja
noch nie gegeizt. Auch was danach folgt, trägt die klare
Rockalbum-Handschrift. Das wunderbare „Antitype“, mit 5:29
längster Song des Albums, ist noch am ehesten, was man mit dem
Genre Prog in Verbindung bringen würde, und auch der Titeltrack
ist ein Heavy-Rocker mit besonderem Twist. Und während
„Linger“ eigentlich das große Bombast-Finale
darstellt, endet das Album letztendlich doch wieder experimentell:
Elektronisch angehaucht schließt „Shipwreck“ den
Kreis zum Anfang des Albums und beweist, dass das Quartett sich nicht
einfach nur zurückgezogen und mit anderen Dingen beschäftigt
hatte, sondern auch für die Rückkehr einiges geändert
hat – wie Gitarrist Thomas Zippner im Interview bestätigt,
dass durchaus auch ein paar Ideen, die den früheren zu
ähnlich waren, einfach rausgeflogen sind. Dass das Album trotzdem
so überzeugend und irgendwie trotz allem auch wieder typisch The
Intersphere geworden ist, beweist ihren Ausnahmestatus – sowohl
qualitativ als auch soundtechnisch.
Wow,
5 Jahre haben sie sich Zeit gelassen. Das ist für die Mannheimer
Jungs, die mit 4 Alben in 5 Jahren gestartet waren, eine verdammt lange
Pause. Und in der Tat haben sie ein paar Dinge umgestellt. Das begann
schon mit der Art zu komponieren in Jam-Manier, statt sich auf durch
Sänger Christoph Hessler vorbereitete Songs zu verlassen, und
setzt sich fort in den ersten vier Songs des Albums. „Think
Twice“ beginnt extrem eingängig, „Man on the
Moon“ wartet gar mit einem Soul-Touch auf und
„Overflow“ mit Uh-Uhs (oder schreibt man
„Ooh-Oohs“?, Immerhin singen sie ja englisch…). Aber
keine Angst, das Ganze mehr oder weniger im Rahmen des
Intersphere-typischen Rock-Universums. Und mit Abwechslung habe sie ja
noch nie gegeizt. Auch was danach folgt, trägt die klare
Rockalbum-Handschrift. Das wunderbare „Antitype“, mit 5:29
längster Song des Albums, ist noch am ehesten, was man mit dem
Genre Prog in Verbindung bringen würde, und auch der Titeltrack
ist ein Heavy-Rocker mit besonderem Twist. Und während
„Linger“ eigentlich das große Bombast-Finale
darstellt, endet das Album letztendlich doch wieder experimentell:
Elektronisch angehaucht schließt „Shipwreck“ den
Kreis zum Anfang des Albums und beweist, dass das Quartett sich nicht
einfach nur zurückgezogen und mit anderen Dingen beschäftigt
hatte, sondern auch für die Rückkehr einiges geändert
hat – wie Gitarrist Thomas Zippner im Interview bestätigt,
dass durchaus auch ein paar Ideen, die den früheren zu
ähnlich waren, einfach rausgeflogen sind. Dass das Album trotzdem
so überzeugend und irgendwie trotz allem auch wieder typisch The
Intersphere geworden ist, beweist ihren Ausnahmestatus – sowohl
qualitativ als auch soundtechnisch.
Für KW 49: Soup - Live Cuts (Stickman Rcords)
Knapp 5 Minuten dauert es, bis der Opener „The Boy And The Snow” richtig losgeht – und die Norweger haben es bis dahin geschafft, die Spannung so hochzuschrauben, dass die hereinbrechenden Gitarren aufgenommen werden, wie ein Schauer im Sommer 2018. Und bei einer Gesamtlänge von 13:30 können sie sich ein bisschen Langsamkeit durchaus leisten. Das nachfolgende ist dagegen etwas ernüchternd: Arg pathetisch und mit einer tranigen Barclay James Harvest Melodie ausgestattet schrauben sie die Messlatte erst einmal wieder runter. Auch das instrumentale „Whore“ lässt es mit 4:46 relativ kurz angehen, bevor die Jungs, die mit diesem Album ihr 10jähriges Jubiläum begehen, wieder richtig loslegen. „Sleepers“ ist schon wieder so ein Highlight, in dem sie sich alle Zeit lassen und den Hörer auf eine gut 12minütige Reise aus Space, Jam und ProgRock mitnehmen. Longtracks, so bleibt festzuhalten, sind die besondere Stärke der Band, dort können sie ihre teils mäandernden, teils repetitiven Sounds irgendwo zwischen Archive, Riverside und Porcupine Tree einbringen. Hin und wieder erweitern sie ihren träumerischen Sound durch Wall-of-Sound-Wände im besten Post-Rock Stil – und damit ist auch das knapp 11-minütige „Clandestine Eyes“ der krönende Abschluss. Schade, dass das Album nur 5 Songs vereint… so hätte es gerne noch eine Weile weitergehen dürfen...
Für KW 48: Simply Red – Symphonica in Rosso (BMG / Warner)
 Es
gab eine Zeit, da war Mick Hucknall der hippste Scheiß. Die Musik
war eine Mischung aus Soul, Jazz und Pop in faszinierend charmanter
Zusammensetzung und Intimität, seine Konzerte waren mega angesagt.
Dann setzte der große Erfolg ein du Simply Red wurden Pop. So
überkandidelt, dass jeglicher hip-Faktor den Bach runterging
– und sogar Mick Hucknall irgendwann seinen Tee auf hatte. Er
öste die Band auf und versuchte, noch einmal als Solist deinen
Neuanfang – bis er erkannte, dass es doch einfacher ist, mit
Simply Red große Kasse zu machen. Der Name stimmte, das
Repertoire war da, also wie seine Kollegen ab durch große Hallen
und Scheine zählen. Innovation war das ohnehin seit Jahren nicht
mehr.
Es
gab eine Zeit, da war Mick Hucknall der hippste Scheiß. Die Musik
war eine Mischung aus Soul, Jazz und Pop in faszinierend charmanter
Zusammensetzung und Intimität, seine Konzerte waren mega angesagt.
Dann setzte der große Erfolg ein du Simply Red wurden Pop. So
überkandidelt, dass jeglicher hip-Faktor den Bach runterging
– und sogar Mick Hucknall irgendwann seinen Tee auf hatte. Er
öste die Band auf und versuchte, noch einmal als Solist deinen
Neuanfang – bis er erkannte, dass es doch einfacher ist, mit
Simply Red große Kasse zu machen. Der Name stimmte, das
Repertoire war da, also wie seine Kollegen ab durch große Hallen
und Scheine zählen. Innovation war das ohnehin seit Jahren nicht
mehr.
Die perverse Krönung des Ganzen ist das Konzert, das für
dieses CD/DVD Package stattfand. Mit 40-köpfigem Orchester und
pompöser Bühnenshow macht er auf André Rieu und
strahlt über alle vier Backen. Alle Hits mit klassischer
Unterstützung – das ist zum Weihnachtsfest genau das
richtige Paket. Wenn man diese ganzen Punkte außer Acht
lässt, ergibt sich letztlich ein Album mit einem Feuerwerk an
Songs, das den Hörer durch fast alle Hits, Höhen und Tiefen
führt.
Für KW 47: 22 - You Are Creating (Longbranch/SPV)
Déja Vu? Logo! Dieses Album war schon CD der Woche in KW 13
2017! Im Grunde müsste ich gar nicht so viel ändern –
nur erweitern, so wie die Band: Dieses Album wurde im Original Anfang
2017 veröffentlicht – und war schon damals eine ungeheuer
kreative Achterbahnfahrt. Die Norweger präsentierten uns mit
immenser Energie, Spritzigkeit, Spielfreude, Musikalität,
Größe und Grandezza ein Potpourri ihrer möglichen
Einflüsse, die von Muse und Me über Spock`s Beard, The
Intersphere, Queen bis zu A.C.T. reichten. Ein kleiner Wehmutstropfen
blieb: Mit seinen 8 Songs und nur 30 Minuten Spielzeit war diese
ungeheuer aufregende Scheibe viel zu schnell vorbei. Vielleicht lag es
daran, vielleicht reichte die Publicity einfach noch nicht aus:
Offensichtlich war die Nachfrage bislang noch nicht angemessen,
weswegen sie sich überlegt haben, nicht einfach ein zweites Album
mit demselben Mangel hinterherzuschieben, sondern es einfach hintenan
zu hängen. So gibt es jetzt das ursprüngliche Album –
und Teil 2 gleich mit dazu. Aus 8 Songs und 30 min werden 16 Songs und
63 Minuten – und so wird ein Schuh draus!
Die Musik ist ähnlich faszinierend geblieben, für die, die
das Debüt schon kennen, dürfte es vielleicht noch einen Tick
einfacher werden, denn wie ich schon damals geschrieben hatte: So
richtig auffallend war die Kürze gar nicht, weil man auch so schon
fast erschlagen war von der immensen Fülle der Musik. Das
könnte beim ersten Hören in diesem Fall noch einen Tick mehr
sein – aber letztendlich will man im Prog doch genau das: Ein
Album, bei dem man auch beim 10., 20. Hören noch immer wieder neue
Dinge entdeckt und faszinierend findet. Hatte ich die eindeutige
Empfehlung 2017 noch ein wenig offen gelassen, führt jetzt
eigentlich nicht mehr viel dran vorbei!
Für KW 46: Twelfth Night - Sequences
 Ein
neues Twelfth Night Album – da macht man erstmal große
Augen! Aber es wirklich so. Mit nagelneuen Aufnahmen – wenn auch
eines altbekannten Songs. Der 23-Minuten Longtrack
„Sequences“ zählte immer zum Live-Set der Band, nach
Brian Devoils Aussage sogar zu den Highlights jedes Gigs, existierte
aber nie in einer Studiofassung. Das haben die Jungs um das
Gründungsmitglied und Sprachrohr der Band jetzt nachgeholt:
„Wir sind stolz auf die Aufnahme – unterschiedlich genug
von der Live-Version, ohne die Essenz des Songs zu verlieren“, so
Devoil. Und in der Tat ist dem Song eine weitere meisterliche Version
hinzugefügt worde. Ursprünglich als Instrumentalversion
auf „Live At The Target” enthalten, wurde er
zunächst von Electra McLeod mit einem Text versehen – als
8-minütige Version auf youtube zu finden. Geoff Mann machte darauf
schließlich das Epos mit neuem Text, der vom “Live and Let
Live” Album bekannt ist. Die Studioversion glänzt nicht nur
mit allen wichtigen, bekannten Elementen dieser Version, sondern
gleichzeitig einen sehr zeitgemäßen Anstrich und Sound, mit
so viel Liebe zum Detail, gerade auch was die Umsetzung zur Story
angeht und mit einem 200-köpfigen Chor aus musikalischen Freunden
Geoff Manns… ein Meisterwerk nicht nur für Fans! Dazu
gesellt sich Mark Spencer von Galahad als Sänger mit unglaublicher
Ähnlichkeit zu Geoff Mann. Da muss man schon sehr genau
hinhören, um das herauszuhören – wobei man dann auch
herausfinden wird, dass von Geoff Mann lediglich die „Regimental
Sergeant Major“-Stelle „Alright my likely lads…
Attention!" auftaucht – entnommen dem original Mastertape des
“Live and Let Live” Albums. Gänsehaut! Die
Ähnlichkeit von Spencers Stimme gab letztlich auch den Ausschlag
für die Entscheidung der Neueinspielung.
Ein
neues Twelfth Night Album – da macht man erstmal große
Augen! Aber es wirklich so. Mit nagelneuen Aufnahmen – wenn auch
eines altbekannten Songs. Der 23-Minuten Longtrack
„Sequences“ zählte immer zum Live-Set der Band, nach
Brian Devoils Aussage sogar zu den Highlights jedes Gigs, existierte
aber nie in einer Studiofassung. Das haben die Jungs um das
Gründungsmitglied und Sprachrohr der Band jetzt nachgeholt:
„Wir sind stolz auf die Aufnahme – unterschiedlich genug
von der Live-Version, ohne die Essenz des Songs zu verlieren“, so
Devoil. Und in der Tat ist dem Song eine weitere meisterliche Version
hinzugefügt worde. Ursprünglich als Instrumentalversion
auf „Live At The Target” enthalten, wurde er
zunächst von Electra McLeod mit einem Text versehen – als
8-minütige Version auf youtube zu finden. Geoff Mann machte darauf
schließlich das Epos mit neuem Text, der vom “Live and Let
Live” Album bekannt ist. Die Studioversion glänzt nicht nur
mit allen wichtigen, bekannten Elementen dieser Version, sondern
gleichzeitig einen sehr zeitgemäßen Anstrich und Sound, mit
so viel Liebe zum Detail, gerade auch was die Umsetzung zur Story
angeht und mit einem 200-köpfigen Chor aus musikalischen Freunden
Geoff Manns… ein Meisterwerk nicht nur für Fans! Dazu
gesellt sich Mark Spencer von Galahad als Sänger mit unglaublicher
Ähnlichkeit zu Geoff Mann. Da muss man schon sehr genau
hinhören, um das herauszuhören – wobei man dann auch
herausfinden wird, dass von Geoff Mann lediglich die „Regimental
Sergeant Major“-Stelle „Alright my likely lads…
Attention!" auftaucht – entnommen dem original Mastertape des
“Live and Let Live” Albums. Gänsehaut! Die
Ähnlichkeit von Spencers Stimme gab letztlich auch den Ausschlag
für die Entscheidung der Neueinspielung.
Passend zum Thema des Songs – die Geschichte eines jungen Mannes,
der in den ersten Weltkrieg zieht und als veränderte Person
zurückkommt – erscheint das Album zum 100jährigen
Jahrestag des Kriegsendes und geht ein Teil des Erlöses an die
´Poppy Appeal´ Royal British Legion, die sich um
Kriegsveteranen und ihre Familien kümmert.
Neben dem Song gibt es übrigens eine Instrumentalversion gleicher
Länger sowie ein knapp 10-minütiges
„Interpretations“ mit Piano-Variationen der drei
Hauptthemen des Songs. Nicht weltbewegend viel, aber immerhin. Und
einmal auf den Geschmack gekommen, hält es Brian Devoil durchaus
für möglich, dass sie sich den einen oder anderen weiteren
Song vornehmen könnten, um ihn erstmals in einer Studioversion
zugänglich zu machen. Oder sogar neue Songs… aber mit
Versprechen hält er sich da lieber zurück.
Für KW 45: Steven Wilson - Home Invasion: In Concert at the Royal Albert Hall
(Eagle Rock / Universal Music)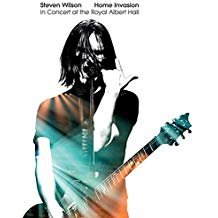
Ein Konzert in der Royal Albert Hall ist und bleibt etwas Besonderes für jeden Musiker, ergo: Man muss ihn aufzeichnen. Steven Wilson hatte den Luxus, Ende März 2018 gleich drei Abende hintereinander ausverkaufen zu können zum Abschluss seiner Tour zum „To The Bone“-Album, auf der er im Februar auch für zwei Abende im Hamburger Mehr!-Theater zu erleben war (wir berichteten). Und wie er bereits in Hamburg angekündigt hatte, dass der zweite Abend „ganz anders werden würde“ – in der Tat spielte er am darauffolgenden Abend gleich sechs Songs erstmals auf dieser Tournee! – wurden auch die drei Abende in der Londoner Konzerthalle sehr unterschiedlich. Die DVD hält allerdings den ersten Abend fest, der nahezu identisch mit dem ersten Hamburger Konzert war – womit der Stellenwert dieses Sets unterstrichen wird – plus ein paar Erweiterungen: Zunächst war Duettpartnerin Ninet Tayeb live dabei – bei „Pariah“ wie auch drei weiteren Songs. Im farbenfrohesten Song seines aktuellen Albums (Kritiker nannten es sein Pop-Album, was insofern stimmte, als es immerhin Platz 3 der britischen und Platz 2 der deutschen Charts erreichte!, was Wilson zur Aussage bringt: „pop music rules!“), „Permanating“, enterte eine Riege von sieben Bollywood Tänzerinnen die Bühne. Besondere Anlässe verdienen besondere Behandlung. All das ergänzt das, was einen Wilson-Gig ohnehin ausmacht: Zweieinhalb Stunden Musik in perfektem Licht und Sound, von Steven selbst in 5.1 Surround Sound und Stereo abgemischt, eine atemberaubend tighte Band, visuelle Effekte und Filme, festgehalten von Kameras, die aus allen erdenklichen Winkeln im Saal und auf der Bühne gefilmt haben. Perfektion ohne Sterilität in einem maximal abwechslungsreichen Set, das sich gekonnt aus seinen letzten 3½ Soloalben sowie einem ganzen Stapel an Porcupine Tree Songs zusammensetzt. MegaHammer! Was für ein Musiker. Was für eine Band. Ich stopp jetzt lieber, sonst schlägt meine Begeisterung gleich Kapriolen. Geht aber gar nicht anders, wenn man diese Show sieht.
PS: Auch nach zweieinhalb Stunden auf der Bühne sieht der Mann nicht anders aus als vorher… wie geht das eigentlich?
PPS: Bonusmaterial: Interview mit SW sowie drei Tracks, aufgezeichnet bei einer Probe in der Royal Albert Hall: Routine, Hand Cannot Erase und Heartattack In A Layby.
Für KW 44: The Holy – Daughter (Playground Music)
 Mit
ihren letzten Alben haben es uns die Editors nicht ganz einfach
gemacht. 2013 veröffentlichten sie ihr Meisterwerk „The
Weight of your love” genau zum richtigen Zeitpunkt, als ihre
Karriere langsam ins Rollen kam. So hätte es weitergehen
können. Stattdessen veröffentlichten sie 2015 „In
Dream“, ein träumerisches, sehr ruhiges Album. Ihr 2018er
„Violence“ war eine Rückkehr zum Rock zumindest in
Teilen – richtig große Hits, geschweige denn Hymnen waren
nicht so richtig dabei. Und das ist, wo The Holy ins Spiel kommen. Das
sind die Editors in Rock! Und sie sind groß! Hymnischer Rock mit
Stadion-Ambitionen mit der Kraft zweier Schlagzeuger. Daneben mit Eetu
Henrik Iivari einen Sänger, der diese Hymnen mit dem richtigen
Pathos begleiten kann (und nicht nur damit Editors-Sänger Tom
Smith sehr ähnlich ist), der aber auch richtig variantenreich
singen kann. Die Finnen aus Helsinki rollen hier einen Gabentisch vor
uns aus, der das Herz schneller schlagen lässt. Acht Songs, von
denen jeder einzelne, das leisere, finale „Letter“
vielleicht einmal ausgenommen, jeden Song der letzten beiden
Editors-Alben - und wahrscheinlich auch alle anderen - übertrifft.
Grandios.
Mit
ihren letzten Alben haben es uns die Editors nicht ganz einfach
gemacht. 2013 veröffentlichten sie ihr Meisterwerk „The
Weight of your love” genau zum richtigen Zeitpunkt, als ihre
Karriere langsam ins Rollen kam. So hätte es weitergehen
können. Stattdessen veröffentlichten sie 2015 „In
Dream“, ein träumerisches, sehr ruhiges Album. Ihr 2018er
„Violence“ war eine Rückkehr zum Rock zumindest in
Teilen – richtig große Hits, geschweige denn Hymnen waren
nicht so richtig dabei. Und das ist, wo The Holy ins Spiel kommen. Das
sind die Editors in Rock! Und sie sind groß! Hymnischer Rock mit
Stadion-Ambitionen mit der Kraft zweier Schlagzeuger. Daneben mit Eetu
Henrik Iivari einen Sänger, der diese Hymnen mit dem richtigen
Pathos begleiten kann (und nicht nur damit Editors-Sänger Tom
Smith sehr ähnlich ist), der aber auch richtig variantenreich
singen kann. Die Finnen aus Helsinki rollen hier einen Gabentisch vor
uns aus, der das Herz schneller schlagen lässt. Acht Songs, von
denen jeder einzelne, das leisere, finale „Letter“
vielleicht einmal ausgenommen, jeden Song der letzten beiden
Editors-Alben - und wahrscheinlich auch alle anderen - übertrifft.
Grandios.
Für KW 43: The Brew - Art of Persuasion (Napalm Records)
 Es
fällt immer noch schwer, sie einem bestimmten Genre zuzuordnen.
Die progressive Blues-Fraktion nennt sie die Erneuerer des Blues,
Hardrocker freuen sich an und über Purple-lastige Rumpelsaiten,
Rock-Fans sprechen von U2-ähnlicher Hitlastigkeit – und ihre
Alben erscheinen auf dem Metal-Label Napalm… diese
Vielseitigkeit macht schon einen Teil des Reizes dieser Band aus. War
ihr letztes Album „Shake The Tree“ daran gemessen schon
überraschend klassisch Blues-Rock-orientiert, glänzen auf
ihrem siebten Werk wieder Edelsteine unterschiedlichster Prägung.
Über dem Album schwebt der Spirit von Led Zeppelin bis Wolfmother,
um hier mal einen adäquaten Anhaltspunkt zu nennen, finaler
Höhepunkt ist das ausufernde „Pink Noise Queen“, aber
auch der kürzeste Song „Shaking the Room“ glänzt
mit Feedback-Solo. Was die Songs eint ist der ansteckende Energielevel,
tolle Hooklines und das dichte Zusammenspiel des Trios, das sich in
kraftvollem Sound, groovenden Rhythmen, exzessiven Soli und hymnischen
Gesang wunderbar ergänzt. Eine Einheit aus Vater und Sohn Smith an
Bass und Drums, auf die sich Bandleader, Sänger und Gitarrist
Jason Barwick jederzeit verlassen kann. Und ab damit zurück auf
die Bühnen!
Es
fällt immer noch schwer, sie einem bestimmten Genre zuzuordnen.
Die progressive Blues-Fraktion nennt sie die Erneuerer des Blues,
Hardrocker freuen sich an und über Purple-lastige Rumpelsaiten,
Rock-Fans sprechen von U2-ähnlicher Hitlastigkeit – und ihre
Alben erscheinen auf dem Metal-Label Napalm… diese
Vielseitigkeit macht schon einen Teil des Reizes dieser Band aus. War
ihr letztes Album „Shake The Tree“ daran gemessen schon
überraschend klassisch Blues-Rock-orientiert, glänzen auf
ihrem siebten Werk wieder Edelsteine unterschiedlichster Prägung.
Über dem Album schwebt der Spirit von Led Zeppelin bis Wolfmother,
um hier mal einen adäquaten Anhaltspunkt zu nennen, finaler
Höhepunkt ist das ausufernde „Pink Noise Queen“, aber
auch der kürzeste Song „Shaking the Room“ glänzt
mit Feedback-Solo. Was die Songs eint ist der ansteckende Energielevel,
tolle Hooklines und das dichte Zusammenspiel des Trios, das sich in
kraftvollem Sound, groovenden Rhythmen, exzessiven Soli und hymnischen
Gesang wunderbar ergänzt. Eine Einheit aus Vater und Sohn Smith an
Bass und Drums, auf die sich Bandleader, Sänger und Gitarrist
Jason Barwick jederzeit verlassen kann. Und ab damit zurück auf
die Bühnen!
Für KW 42: Anathema - Internal Landscapes 2008 – 2018 (Kscope/Edel)
 16
Monate ist das letzte Studioalbum der Briten alt – und bei allen
Wünschen nach neuem Material ist es durchaus verständlich und
nachvollziehbar, dass es noch kein neues Album gibt. Geben wir ihnen
also noch etwas Zeit – die sie (hoffentlich nur nebenbei) nutzen,
um trotzdem von sich Reden zu machen. Mit einer Werkschau auf die
letzten zehn Jahre. Wobei die Auswahl des Zeitrahmens wahrscheinlich
vertragliche Gründe hat und mit dem Wechsel zum Kscope-Label zu
tun hat, mit dem Jahr 2008 aber trotzdem interessant betitelt ist, weil
es zwischen 2003 und 2010 gar kein neues Album gab. Vielleicht klang
08-18 einfach besser.
16
Monate ist das letzte Studioalbum der Briten alt – und bei allen
Wünschen nach neuem Material ist es durchaus verständlich und
nachvollziehbar, dass es noch kein neues Album gibt. Geben wir ihnen
also noch etwas Zeit – die sie (hoffentlich nur nebenbei) nutzen,
um trotzdem von sich Reden zu machen. Mit einer Werkschau auf die
letzten zehn Jahre. Wobei die Auswahl des Zeitrahmens wahrscheinlich
vertragliche Gründe hat und mit dem Wechsel zum Kscope-Label zu
tun hat, mit dem Jahr 2008 aber trotzdem interessant betitelt ist, weil
es zwischen 2003 und 2010 gar kein neues Album gab. Vielleicht klang
08-18 einfach besser.
Zu hören gibt es 13 Songs aus ihren letzten vier Werken, die sich
nacheinander gegenseitig übertrafen an Songhighlights und immer
noch zum Besten gehören, was in dieser Zeit erschienen ist in dem
von ihnen geschaffenen Feld aus Rock und Prog und New Artrock –
oder wie ihre Plattenfirma es nennt: Dramatic Post-Progressive
Alternative Rock. Eine Wucht aus monumentalen Alben mit epischen Songs
voller pompöser Schönheit zwischen Pink Floyd, Sigur Ros und
Porcupine-Tree. Sie haben die Latten ganz schön hoch
geschraubt… lassen wir ihnen die Zeit die sie brauchen, um
weitere Songs dieser Klasse zu komponieren und freuen uns über
diese Rückschau. Besonderheit ist übrigens die instrumentale
Softversion von „J'ai fait une promesse“ – einem Song
ihres 93er (Doom-Metal-)Debütalbums!
Für KW 41: Birdpen - There`s something wrong with everything (Jar Records/RTD)
Nach der Entwicklung, die Archive mit ihren letzten Alben genommen
haben, kann man froh sein, dass es Birdpen gibt. Denn während
Archive ihren Sound stetig verändern – und das zuletzt eben
wieder verstärkt elektronisch, bzw. fast Dancefloor-orientiert,
was die anschließenden Konzerte dann noch bekräftigten,
bleiben Birdpen linientreuer. Und behalten Gitarren in ihrem
Instrumentenrepertoire. Gitarren, die auch mitreden dürfen.
Die Grundausrichtung beider Bands – die mit Dave Pen ja ein
gemeinsames Mitglied haben – war seit jeher ähnlich:
Psychedelische Elemente, hypnotische Wirkung durch Loops und
Wiederholungen, Pink Floyd-Referenzen. Nur vom Sound-, Instrumenten-
und Abwechslungs-Repertoire her machen das Birdpen momentan deutlich
spannender und interessanter als Archive. Innovation geht indes anders
– aber das muss man ja vielleicht gar nicht immer haben.
Für KW 40: IQ - Ever – 25th Anniversary Collector`s Edition (GEP)
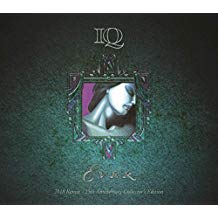 Dieses
Album markierte 1993 die Rückkehr von Sänger Peter Nicholls
zur Band – und die Rückkehr der Band an die Spitze der
wiedererstarkenden Prog-Bewegung der 90er. Zwei Alben hatte Nicholls in
den 80ern mit IQ aufgenommen, dann hatte Paul Menel für zwei Alben
das Mikro übernommen, bevor die Band langsam in der Versenkung
verschwand. Mit diesem Album kamen sie nach vier Jahren Albumpause
zurück. Mit einem Sound, der auf ihren stärksten Momenten
aufbaute, den Sound aber ins neue Jahrzehnt holte. Bombastisch,
detailverliebt, aber nie überdreht, mit einer tollen Balance aus
Prog und Rock, mal energetisch rockig, mal ruhig verträumt –
ein neues Highlight der Band, die sich schon bis dahin eine riesige
Fanbasis aufgebaut hatte, mit diesem Album aber wie gesagt sich selbst
auf ein neues Level hob. Und obwohl „Ever“ schon
damals mit einem wuchtigen Sound aufwartete, bekommt das Album jetzt
zum 25. Jubiläum noch einmal eine Auffrischung. Mike Holmes (und
der Rest der Band) überarbeitete das komplette Material für
einen „2018 Remix“, schickt dem finalen „Came
down“ noch eine Verlängerung hinterher und besorgte dem
Opener „Darkest Hour“ noch eine komplette
Alternativversion. Die vorliegende Geburtstags-Edition enthält nun
auf CD 1 den Remix, auf CD 2 eine Live-Aufnahme des Albums vom Februar
2018 in Aschaffenburg, ein fettes Booklet sowie eine Bonus-DVD mit jeder Menge Extras als
MP3: Dem Remix, dem 5.1 Surround Sound Mix, Album Demos, Studio
Outtakes und unveröffentlichte Song-Demos, Rehearsals sowie
obendrauf das Video der o.g. Live-Show in Bild und Ton. Kompliment!!
Eine würdige Ehrung für einen Meilenstein der 90er.
Dieses
Album markierte 1993 die Rückkehr von Sänger Peter Nicholls
zur Band – und die Rückkehr der Band an die Spitze der
wiedererstarkenden Prog-Bewegung der 90er. Zwei Alben hatte Nicholls in
den 80ern mit IQ aufgenommen, dann hatte Paul Menel für zwei Alben
das Mikro übernommen, bevor die Band langsam in der Versenkung
verschwand. Mit diesem Album kamen sie nach vier Jahren Albumpause
zurück. Mit einem Sound, der auf ihren stärksten Momenten
aufbaute, den Sound aber ins neue Jahrzehnt holte. Bombastisch,
detailverliebt, aber nie überdreht, mit einer tollen Balance aus
Prog und Rock, mal energetisch rockig, mal ruhig verträumt –
ein neues Highlight der Band, die sich schon bis dahin eine riesige
Fanbasis aufgebaut hatte, mit diesem Album aber wie gesagt sich selbst
auf ein neues Level hob. Und obwohl „Ever“ schon
damals mit einem wuchtigen Sound aufwartete, bekommt das Album jetzt
zum 25. Jubiläum noch einmal eine Auffrischung. Mike Holmes (und
der Rest der Band) überarbeitete das komplette Material für
einen „2018 Remix“, schickt dem finalen „Came
down“ noch eine Verlängerung hinterher und besorgte dem
Opener „Darkest Hour“ noch eine komplette
Alternativversion. Die vorliegende Geburtstags-Edition enthält nun
auf CD 1 den Remix, auf CD 2 eine Live-Aufnahme des Albums vom Februar
2018 in Aschaffenburg, ein fettes Booklet sowie eine Bonus-DVD mit jeder Menge Extras als
MP3: Dem Remix, dem 5.1 Surround Sound Mix, Album Demos, Studio
Outtakes und unveröffentlichte Song-Demos, Rehearsals sowie
obendrauf das Video der o.g. Live-Show in Bild und Ton. Kompliment!!
Eine würdige Ehrung für einen Meilenstein der 90er.
Für KW 39: Villagers - The Art of Pretending to Swim (Domino Recording)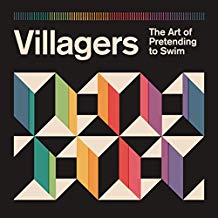
Mit „The Art Of Pretending To Swim“ legt der irische Künstler Conor O’Brien sein viertes Studioalbum vor: Ein flirrendes Kunstwerk zwischen Electro und Pop, eine Sammlung eingängiger Melodien, die anspruchsvoll erweitert wurden mit Soul-Elementen, intelligenten Rhythmen und einem umwerfenden Spektrum akustischer Details. Eine faszinierende Gratwanderung zwischen banalem Mainstream und opulenter Radiohead-Spielkunst. Das Album wurde von Conor O’ Brien in seinem Studio in Dublin geschrieben, produziert, gemischt und zu ganz großen Teilen auch eingespielt. Spannend! Im November sind die Villagers damit auf Tournee: 3.11. Frankfurt, 6.11. Hamburg, 8.11. Berlin, 27.11. Köln.
Für KW 38: Nosound - Allow Yourself (Kscope)
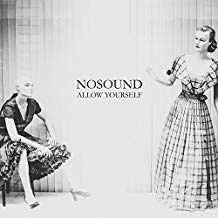 Die
Italiener haben sich meiner Ansicht nach keinen Gefallen getan, sich
namentlich so nah an die Briten No-Man heranzupirschen. Musikalische
Parallelen gab es, und zu allem Überfluss gastierte No-Man
Frontmann Tim Bowness mit seiner extrem polarisierenden Stimme auf
ihrem 2008er Debüt auch noch als Gastsänger. Da bekommt man
schnell einen Stempel, der so schnell nicht wieder verblasst. Dabei hat
diese Band wesentlich mehr zu bieten, das beweist spätestens ihr
neues Album „Allow Yourself“. Schon die erste Single
„Don`t you dare“ erinnerte extrem an Radiohead mit seiner
elektrisierenden Mischung aus Ambient, Artrock und Psychedelia und auch
der Rest des Albums spielt abwechslungsreich mit diesen Zutaten, weiter
ergänzt durch Post- und Alternative-Rock-Sounds. Das ergibt eine
Bandbreite an möglichen Vergleichen, die von Brian Eno über
Pink Floyd und Sigur Ros bis zu Mogwai reicht – und ein Album,
dass definitiv mehr ist, als die Schlafwagenberieselung von No-Man!
Die
Italiener haben sich meiner Ansicht nach keinen Gefallen getan, sich
namentlich so nah an die Briten No-Man heranzupirschen. Musikalische
Parallelen gab es, und zu allem Überfluss gastierte No-Man
Frontmann Tim Bowness mit seiner extrem polarisierenden Stimme auf
ihrem 2008er Debüt auch noch als Gastsänger. Da bekommt man
schnell einen Stempel, der so schnell nicht wieder verblasst. Dabei hat
diese Band wesentlich mehr zu bieten, das beweist spätestens ihr
neues Album „Allow Yourself“. Schon die erste Single
„Don`t you dare“ erinnerte extrem an Radiohead mit seiner
elektrisierenden Mischung aus Ambient, Artrock und Psychedelia und auch
der Rest des Albums spielt abwechslungsreich mit diesen Zutaten, weiter
ergänzt durch Post- und Alternative-Rock-Sounds. Das ergibt eine
Bandbreite an möglichen Vergleichen, die von Brian Eno über
Pink Floyd und Sigur Ros bis zu Mogwai reicht – und ein Album,
dass definitiv mehr ist, als die Schlafwagenberieselung von No-Man!
Für KW 37: We Were Promised Jetpacks - The More I Sleep The Less I Dream (Big Scary Monsters / AL!VE)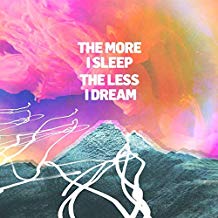
Die Schotten, die wahrscheinlich immer noch auf ihre Verpflegung im Billigflieger aus dem Nachbarland warten (oder was sonst sollen Jetpacks sein?), sind seit 15 Jahren unterwegs mit einer Mischung aus Indie Pop und Rock, Postrock, Postpunk und ein paar interessanten 80s-Referenzen. Shoegaze, 12 Drummers Drumming, vor allem aber interessante Sounds aus der Region – Areogramme und Mogwai als Glasgower Nachbarn, bzw., noch ein paar Kilometer weiter westlich, die irischen The Frames sind hier mögliche Referenzen. Mit ihrem vierten Album wollen die Jungs aus Edinburgh ein neues Kapitel aufschlagen. Da ich ihre ersten Werke nicht kenne, lass ich das für die Insider mal so stehen, kann aber allen anderen, die bei den genannten Namen hellhörig geworden sind, dringend anraten, hier mal reinzuhören, denn „The More I Sleep The Less I Dream“ ist ein extrem spannendes und abwechslungsreiches Album. Schon der Beginn ist mit „Impossible“ und „In Light“ gut gewählt, aber auch im weiteren Verlauf gibt es immer wieder Highlights wie „Make it Easier“ oder „Not Wanted“. Hört selbst rein!
Für KW 36: Foxing - Nearer My God (Triple Crown)
 Die
vier Jungs aus St. Louis haben drei Jahre an ihrem dritten Album
gearbeitet – und wenn man durch ihre Biografie scrollt, sind sie
Kummer gewohnt. Aber sie wachsen mit jedem Rückschlag – und
machen daraus Songs und Alben, die dich umhauen! Allein der Beginn
ihres neuen Albums ist der Hammer. „Grand Paradise“ ist
eine unglaublich mitreißende Mischung aus Hookline, Bombast und
Hymne, die nachfolgende erste Single „Slapstick“ nimmt die
Stimmung gleich weiter auf, dreht sie aber in den folgenden 3 Minuten
in eine komplett neue Richtung.
Die
vier Jungs aus St. Louis haben drei Jahre an ihrem dritten Album
gearbeitet – und wenn man durch ihre Biografie scrollt, sind sie
Kummer gewohnt. Aber sie wachsen mit jedem Rückschlag – und
machen daraus Songs und Alben, die dich umhauen! Allein der Beginn
ihres neuen Albums ist der Hammer. „Grand Paradise“ ist
eine unglaublich mitreißende Mischung aus Hookline, Bombast und
Hymne, die nachfolgende erste Single „Slapstick“ nimmt die
Stimmung gleich weiter auf, dreht sie aber in den folgenden 3 Minuten
in eine komplett neue Richtung.
Nehmt mal neuere Skunk Anansie als ersten musikalischen Anhaltspunkt,
addiert etwas Industrial Elektronik im Stile Filter, dazu ein wenig Red
Hot Chili-Groove und geht von da in Richtung atmosphärischen Post
Rocks, dann kommt ihr irgendwie auf abwechslungsreichen Wegen zu
Foxing. Zwar ist der Rest des Albums nicht zu jeder Zeit so
spektakulär wie sein Beginn, aber es wird niemals langweilig. Und
professionell produziert von Chris Walla kann man den Amerikanern nur
eine adäquate Plattform wünschen, um ihre Kunst
präsentieren zu können.
Für KW 35: The Pineapple Thief - Dissolution (Kscope/Edel)
Die Namensähnlichkeit ist natürlich rein zufällig, aber in der Tat könnte jetzt, nachdem The Porcupine Tree, respektive Steven Wilson im Big Business angekommen ist, die Band The Pineapple Thief um Mastermind Bruce Soord der nächste große Act mit ähnlichem Werdegang werden. Groß geworden in der treuen Szene des Progressive Rock, mit Bands wie Vulgar Unicorn, zeitlebens sträflich unterbewertet und unbeachtet, sowie deren Nachfolger, augenzwinkernd Persona Non Grata benannt. 1999 kanalisierte er die gemachten Erfahrungen in neue Bahnen mit seiner Band Pineapple Thief und begann seine Erfolgsgeschichte. Nur noch entfernt im Progressive Rock verwurzelt waren es Sound- und Stilelemente von Bands wie Radiohead, Pink Floyd oder Muse, die seinen Klangkosmos erweiterten. Spätestens mit dem grandiosen 2010er Album "Someone Here Is Missing" erhielt die Band auch über alle Genregrenzen hinaus beste Kritiken. In der Folge wurde immer wieder an anderen Stellen experimentiert und erweitert, aber die Grundstruktur aus Rock zwischen Pop und Kunst hat sich nicht verändert. Auch das neue Album „Dissolution“ glänzt mit 9 Songs, die abwechslungsreicher sind, als vieles, was er in den letzten 20 Jahren an den Start gebracht hat, die aber zusammen eine brillante Einheit bilden. Und mit „White Mist“ ist erstmals auch wieder ein Song über 10 Minuten dabei, womit er nicht nur zu seinen eigenen Wurzeln zurückkehrt, sondern auch dem eingangs erwähnten Steven Wilson ernsthafte Konkurrenz bereitet. Ein absolutes Meisterwerk!
Für KW 34: Interpol - Marauder (Matador)
 Mit
dem letzten Album „El Pintor“ schienen sie ein wenig in
Richtung Stadion(Pop)Rock u schielen…, womit sie sich vielleicht
ein bisschen zu viel vorgenommen haben. „Marauder“ klingt
als hätten sie die Vorzüge eines heißen Club-Gigs
wieder zu schätzen gelernt – jedenfalls klingt ihr Album so,
als gehöre es genau da hin. Irgendwo zwischen Rock und New Wave,
zwischen David Bowie und Editors, das Ganze von MGMT- und Flaming-Lips-
Produzent Dave Fridmann zwischen Indie-Rock und Post-Punk zu rauen
Edelsteinen geschliffen: Mit zündenden Hooklines und Ideen aber
mit Kanten und Ecken und letztendlich schnörkellos und direkt,
energetisch und abwechslungsreich. Das ist Interpol pur und richtig
gut! Zu allem Überfluss spielen sie aber in einer von Hamburgs
größten Arenen: Am 23.11. im Mehr! Theater. Der Erfolg
fordert seinen Tribut.
Mit
dem letzten Album „El Pintor“ schienen sie ein wenig in
Richtung Stadion(Pop)Rock u schielen…, womit sie sich vielleicht
ein bisschen zu viel vorgenommen haben. „Marauder“ klingt
als hätten sie die Vorzüge eines heißen Club-Gigs
wieder zu schätzen gelernt – jedenfalls klingt ihr Album so,
als gehöre es genau da hin. Irgendwo zwischen Rock und New Wave,
zwischen David Bowie und Editors, das Ganze von MGMT- und Flaming-Lips-
Produzent Dave Fridmann zwischen Indie-Rock und Post-Punk zu rauen
Edelsteinen geschliffen: Mit zündenden Hooklines und Ideen aber
mit Kanten und Ecken und letztendlich schnörkellos und direkt,
energetisch und abwechslungsreich. Das ist Interpol pur und richtig
gut! Zu allem Überfluss spielen sie aber in einer von Hamburgs
größten Arenen: Am 23.11. im Mehr! Theater. Der Erfolg
fordert seinen Tribut.
Für KW 33: Tangled Thoughts of Leaving - No Tether (Bird's Robe / Dunk! Records )
Ein Album für die Experimentierfreudigeren: Tangled Thoughts of Leaving wechseln auf eindrucksvolle Art zwischen Stilen und Lautstärken. Sie starten leise und behutsam, steigern sich in „The Alarmist“ in lärmendes PostRock-Gewitter, bevor sie auf fast Jazz-ähnliche Art zurück in die psychedelische Stille kehren. Was hier mit Trackmarks noch in drei Einzelsongs zwischen drei und knapp 8 Minuten aufgeteilt ist, passiert im folgenden „Signal Erosion“ als einzelner knapp 13-Minüter in ähnlicher Art und Weise. Und auch der Rest des Albums setzt die Klangreise durch Jazz, Impro, Psychedelic und Post Rock fort in einer Art, die trotz aller Referenzen der Vielzahl gar nicht allzu weit entfernt gelagerter Bands in seiner Art einzigartig ist. Die Plattenfirma verweist auf zwei Alben der Band aus Perth, das Internet findet noch eine ganze Menge weiterer Veröffentlichungen, u.a. einer Split EP mit sleepmakewaves von 2009. Das nur am Rande. Tolle Band!
Für KW 32: Delta Sleep - Ghost City (Big Scary Monsters / AL!VE)
 Indie-Rock
gepaart mit ein wenig Punk und Emo und ein paar elektronischen
Elementen, das Ganze in spannenden und abwechslungsreichen
Arrangements, die man vereinzelt auch dem Math-Rock zuordnen
möchte: Das zweite Album des Quartetts aus Canterbury bei Brighton
ist ein Meisterwerk! Abwechslungsreicher Gesang, Songs, deren Anfang in
den seltensten Fällen den weiteren Verlauf vorherahnen lassen,
jede Menge Dynamik und Emotion. „Dieses Album fühlt sich wie
eine Momentaufnahme der Songs zum Zeitpunkt der Aufnahme an,“
sagt Bassist Dave Jackson. „Man kann sogar hin und wieder kleine
Schönheitsfehler hören. Ein paar Songs wurde an diesen Tagen
sogar kurzerhand improvisiert.“ Alles andere als improvisiert ist
die Story: Konzeptionell ein Tech-Noir, in dem die Welt als eine Stadt
in dem kollektiven Bewusstsein und unter der Herrschaft riesiger
Tech-Firmen agiert – Natur und Tierwelt gehören der
Vergangenheit an. Im Mittelpunkt steht eine Protagonistin, die als
kleines Zahnrad in einer großen Maschine existiert. Eine
düstere und dystopische Story, mit einigen aufmunternden und
seltsam kathartischen Momenten, die von Existenzialismus, Weltlichkeit,
Unterdrückung und den negativen Auswirkungen der Technologie auf
die Welt handelt. Viele gute Gründe, dich mit diesem Album zu
beschäftigen!
Indie-Rock
gepaart mit ein wenig Punk und Emo und ein paar elektronischen
Elementen, das Ganze in spannenden und abwechslungsreichen
Arrangements, die man vereinzelt auch dem Math-Rock zuordnen
möchte: Das zweite Album des Quartetts aus Canterbury bei Brighton
ist ein Meisterwerk! Abwechslungsreicher Gesang, Songs, deren Anfang in
den seltensten Fällen den weiteren Verlauf vorherahnen lassen,
jede Menge Dynamik und Emotion. „Dieses Album fühlt sich wie
eine Momentaufnahme der Songs zum Zeitpunkt der Aufnahme an,“
sagt Bassist Dave Jackson. „Man kann sogar hin und wieder kleine
Schönheitsfehler hören. Ein paar Songs wurde an diesen Tagen
sogar kurzerhand improvisiert.“ Alles andere als improvisiert ist
die Story: Konzeptionell ein Tech-Noir, in dem die Welt als eine Stadt
in dem kollektiven Bewusstsein und unter der Herrschaft riesiger
Tech-Firmen agiert – Natur und Tierwelt gehören der
Vergangenheit an. Im Mittelpunkt steht eine Protagonistin, die als
kleines Zahnrad in einer großen Maschine existiert. Eine
düstere und dystopische Story, mit einigen aufmunternden und
seltsam kathartischen Momenten, die von Existenzialismus, Weltlichkeit,
Unterdrückung und den negativen Auswirkungen der Technologie auf
die Welt handelt. Viele gute Gründe, dich mit diesem Album zu
beschäftigen!
Für KW 31: Arena - Double Vision (Verglas Music)
 Die
Berichterstattung zur Wiederveröffentlichung und Tour zum 20.
Jubiläum ihres Klassikeralbums „The Visitor“ war
bislang prominenter vertreten als die zu ihrem neuen Album. Das muss
dringend geändert werden, denn „The Visitor“ wurde ja
1998 schon angemessen gefeiert – und „Double Vision“
wuchert mit ähnlichen Pfunden. Das erste Album seit 2015 leiht
schon seinen Titel einem Stück des 98er-Werkes und im Vergleich zu
den bisherigen Alben mit Sänger Paul Manzi ist es deutlich mehr
retro als seine Vorgänger. Tolle Songs, tolle Abwechslung, Manzi
hat den passenden Ton zur Band gefunden und seine Shouter Attitüde
abgelegt und auch die Heavyelemente sind auf ein gesundes Maß
zurückgefahren. Es mag sein, dass auch die Band über die
Arbeit an ihrem Klassiker auf alte Stärken aufmerksam geworden
ist. Wen es also nicht stört, dass dieses Album einmal mehr die
typischen Cinemascope-Prog-Sounds auffährt – aber darum geht
es ja wohl bei einem Großteil der Bands dieses Genres – der
sollte mit diesem Album bestens bedient werden!
Die
Berichterstattung zur Wiederveröffentlichung und Tour zum 20.
Jubiläum ihres Klassikeralbums „The Visitor“ war
bislang prominenter vertreten als die zu ihrem neuen Album. Das muss
dringend geändert werden, denn „The Visitor“ wurde ja
1998 schon angemessen gefeiert – und „Double Vision“
wuchert mit ähnlichen Pfunden. Das erste Album seit 2015 leiht
schon seinen Titel einem Stück des 98er-Werkes und im Vergleich zu
den bisherigen Alben mit Sänger Paul Manzi ist es deutlich mehr
retro als seine Vorgänger. Tolle Songs, tolle Abwechslung, Manzi
hat den passenden Ton zur Band gefunden und seine Shouter Attitüde
abgelegt und auch die Heavyelemente sind auf ein gesundes Maß
zurückgefahren. Es mag sein, dass auch die Band über die
Arbeit an ihrem Klassiker auf alte Stärken aufmerksam geworden
ist. Wen es also nicht stört, dass dieses Album einmal mehr die
typischen Cinemascope-Prog-Sounds auffährt – aber darum geht
es ja wohl bei einem Großteil der Bands dieses Genres – der
sollte mit diesem Album bestens bedient werden!
Für KW 30: Marillion - All one tonight (Racket / e-a-r-MUSIC)
Es gibt Konzerthallen und Arenen, die viele Musiker immer noch als
Krönung ihres Schaffens ansehen – und die Royal Albert Hall
in London ist eine davon. Am 13. Oktober 2017 hatten Marillion
dort ihren ersten Auftritt und auch sie nutzten diesen Abend für
ein besonderes Event. Als Fast-Abschluss ihrer „Fuck Everyone and
Run“-Tour (es folgte noch 1 Auftritt damit in Japan), geht es im
ersten Teil – und hier auf CD 1 – um genau dieses Album als
Komplettversion. Über den Wert solcher Aufführungen mag man
geteilter Meinung sein. Natürlich ist es immer spannend, so etwas
in Gänze zu spielen und auch „FEAR“ verdiente
zweifelsohne diese Behandlung, war mir aber ehrlich gesagt schon live
mit zu vielen Längen verbunden, weil es dem Album einfach zu oft
an Power fehlt, die ich mir für ein Marillion Konzert
gewünscht hätte. Auf CD macht das nicht viel mehr Sinn, weil
sich die Version zur Studiofassung zu wenig unterscheidet.
Dem Anlass angemessen wird es danach: Auf CD 2 wird die Band von
einem Streichquartett plus Flöte und Horn begleitet, und das klingt dann schon genial
– und wird auch durch entsprechende Arrangement-Erweiterungen
ergänzt. Und „in praise of folly and guests“, so der
ironische Untertitel dieser CD, gibt es Songs, zu der diese
symphonische Verstärkung besonders passt. Klassiker, die durch
diese Art Tiefgang noch an Größe gewinnen – „The
Space“, „Afraid of Sunlight“, „Waiting to
Happen“, „Neverland“ usw. – und die diesen
Abend zu etwas ganz besonderem machen. Diese CD ist dann auch der
Hauptgrund für diese Veröffentlichung – und für
seine Anschaffung :-) .
Für KW 29: Hoobastank - Push Pull (Napalm Records)
 Eine
weitere Band, die in einer Nische angefangen hat, sich eine Fanbasis
und Credibility erarbeitet hat und dann langsam in den Kommerz
rübergemacht hat. Da hatte man sich mit „The Reason“
ja auch schon einen Namen gemacht - aber ich erinnere mich an
eine DVD "La Cigale" aus frühen Tagen, auf der sie ein Konzert mit
zwanzigköpfigem Orchester
festgehalten hatten, das sie mit Bratzgitarrenbreitseite mal eben an
die
Wand geblasen haben... Das neue Album ist also deutlich
gemäßigter, großteils fast Pop/Rock und auch die Wahl
des Covers spricht Bände: tff „Head over heals“, ohne
dass sie ihm viel mitgegeben hätten – bei dem Sänger
Douglas Robb übrigens erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem
Original
offenbart; vllt. haben sie es auch deswegen gewählt. Echte
ROCKsongs (die ein Blick auf das Label der Band nahelegen
könnte…) sind eher Mangelware, gelungen ist das Album aber
trotzdem. Abwechslung, gute Songs – für die Band könnte
das statustechnisch durchaus ein weiterer Schritt werden!
Eine
weitere Band, die in einer Nische angefangen hat, sich eine Fanbasis
und Credibility erarbeitet hat und dann langsam in den Kommerz
rübergemacht hat. Da hatte man sich mit „The Reason“
ja auch schon einen Namen gemacht - aber ich erinnere mich an
eine DVD "La Cigale" aus frühen Tagen, auf der sie ein Konzert mit
zwanzigköpfigem Orchester
festgehalten hatten, das sie mit Bratzgitarrenbreitseite mal eben an
die
Wand geblasen haben... Das neue Album ist also deutlich
gemäßigter, großteils fast Pop/Rock und auch die Wahl
des Covers spricht Bände: tff „Head over heals“, ohne
dass sie ihm viel mitgegeben hätten – bei dem Sänger
Douglas Robb übrigens erstaunliche Ähnlichkeiten mit dem
Original
offenbart; vllt. haben sie es auch deswegen gewählt. Echte
ROCKsongs (die ein Blick auf das Label der Band nahelegen
könnte…) sind eher Mangelware, gelungen ist das Album aber
trotzdem. Abwechslung, gute Songs – für die Band könnte
das statustechnisch durchaus ein weiterer Schritt werden!
Für KW 28: Southern Empire - Civilisation (GEP)
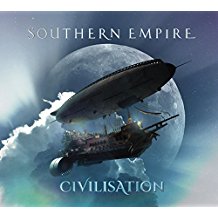 Das
selbstbetitelte Debüt der Australier hatte vor zwei Jahren meinen
CD Player eine ganze Weile per Dauerrotation belegt. Die neue Band von
Unitopia-Hauptsongwriter, Keyboarder und Produzent Sean Timms konnte
mit einer vielschichtigen Mischung aus Prog und Melodic Rock und mit
Referenzen an Transatlantic und Saga genauso wie Supertramp und Sting
begeistern. Entsprechend erwartungsvoll darf dem neuen Album begegnet
werden. Und mit dem Opener „Goliath`s Moon“ starten sie mit
einem Feuerwerk! Vom knalligen Beginn über die Abwechslung mit
Hook und Anspruch bis zum großen Finale besitzt dieser Song in
– für die Band und für dieses Album – kompakten 9
Minuten alles, was die Band ausmacht. Die weiteren drei Songs sind
länger: Bis zu 30 Minuten lassen sie sich Zeit. Wobei das folgende
„Cries…“ sich noch ein wenig zu verrennen scheint
zwischen noch plakativerer Hookline und noch mehr, zunächst
teilweise aufgesetzt wirkenden Prog-Elementen, was nicht ganz so
erfolgreich ist und erst im bombastischen Finale nochmal ordentlich
Punkte sammelt. „Crossroads“ ist dann schließlich das
Meisterwerk in bestem Transatlantic-Stil – deren
Down-Under-Pendant Potential hatte ich ihnen zum Debüt ja schon
bescheinigt – abwechslungs- und variationsreich, 30 Minuten ohne
Längen; ganz groß!
Das
selbstbetitelte Debüt der Australier hatte vor zwei Jahren meinen
CD Player eine ganze Weile per Dauerrotation belegt. Die neue Band von
Unitopia-Hauptsongwriter, Keyboarder und Produzent Sean Timms konnte
mit einer vielschichtigen Mischung aus Prog und Melodic Rock und mit
Referenzen an Transatlantic und Saga genauso wie Supertramp und Sting
begeistern. Entsprechend erwartungsvoll darf dem neuen Album begegnet
werden. Und mit dem Opener „Goliath`s Moon“ starten sie mit
einem Feuerwerk! Vom knalligen Beginn über die Abwechslung mit
Hook und Anspruch bis zum großen Finale besitzt dieser Song in
– für die Band und für dieses Album – kompakten 9
Minuten alles, was die Band ausmacht. Die weiteren drei Songs sind
länger: Bis zu 30 Minuten lassen sie sich Zeit. Wobei das folgende
„Cries…“ sich noch ein wenig zu verrennen scheint
zwischen noch plakativerer Hookline und noch mehr, zunächst
teilweise aufgesetzt wirkenden Prog-Elementen, was nicht ganz so
erfolgreich ist und erst im bombastischen Finale nochmal ordentlich
Punkte sammelt. „Crossroads“ ist dann schließlich das
Meisterwerk in bestem Transatlantic-Stil – deren
Down-Under-Pendant Potential hatte ich ihnen zum Debüt ja schon
bescheinigt – abwechslungs- und variationsreich, 30 Minuten ohne
Längen; ganz groß!
Fazit: Die Band kann die Erwartungen erfüllen und präsentiert
ein weiteres Meisterwerk, ohne sich zu wiederholen oder die
Debütformel einfach nur fortzusetzen. Nach The Sea Within (s.u., KW 27) jetzt
Southern Empire – von Sommerloch kann hier zumindest qualitativ
nicht die Rede sein!
Für KW 27: The Sea Within - The Sea Within (InsideOut/Sony)
Roine Stolt als Kopf, bzw. Initiator einer neuen Supergroup? Auch
wenn er sich dieser Bezeichnung derzeit noch verwehrt, macht ihr erstes
gemeinsames Album alle Anstalten, in diese Kategorie zu fallen. Denn
immerhin hat er mit Daniel Gildenlöw, Jonas Reingold, Tom Brislin
und Marco  Minnemann
nicht irgendwelche Musiker um sich geschart, sondern Meister ihres
Fachs. Und auch Sänger und Gitarrist Casey McPherson hat sich
nicht zuletzt durch Flying Colors schon einige Freunde gemacht. Was ist
also das musikalische Ergebnis? Es ist unbestreitbar, dass da eine
Menge Flower Kings drinsteckt, aber auch nicht viel weniger
Transatlantic und Flying Colors. Und trotzdem: Die schwedischen
Stimmungen in amerikanischen Arrangements und Produktion sowie der
Gesang McPhersons – das ist langstreckenweise schon klar mehr
Rock als Prog.
Minnemann
nicht irgendwelche Musiker um sich geschart, sondern Meister ihres
Fachs. Und auch Sänger und Gitarrist Casey McPherson hat sich
nicht zuletzt durch Flying Colors schon einige Freunde gemacht. Was ist
also das musikalische Ergebnis? Es ist unbestreitbar, dass da eine
Menge Flower Kings drinsteckt, aber auch nicht viel weniger
Transatlantic und Flying Colors. Und trotzdem: Die schwedischen
Stimmungen in amerikanischen Arrangements und Produktion sowie der
Gesang McPhersons – das ist langstreckenweise schon klar mehr
Rock als Prog.
Das ändern auch instrumentale Kabinetteinlagen wie „Sea
without“ und die Präsenz von Longtracks wie „Broken
Cord“ (14:11, drei weitere Songs sind über 7 Minuten) nicht
– aber sie machen das Album für reine Progfans definitiv
noch interessanter. Ansonsten steht der Song im Mittelpunkt – und
wird durch verschiedenste Zutaten verfeinert. Mal ein ausschweifendes
Gitarrensolo, mal ein genialer Jazzpart („Eye for an Eye“),
v.a. aber immer wieder so elektrisierende Momente, in denen entspannte
Intrumentalparts dem Song noch einmal eine neue Wendung geben.
Gäste wie Jordan Rudess, Jon Anderson und Rob Townsend sollten
nicht unerwähnt bleiben, aber es bleiben die Qualität der
Songs und die Arrangements fern jeder schneller, vertrackter,
augefallener-Philosophie, die dieses Album zu einem echten Highlight
des Jahres machen! Außerdem gibt es noch ein Bonusalbum mit 4
weiteren grandiosen Songs, die zeigen, wie anders – und durchaus
progressiver – die Stimmung hätte werden können, wenn
Daniel Gildenlöw den Job als Frontmann übernommen, bzw.
behalten hätte. Ich fürchte, gegen die Bezeichnung
´Supergroup` werden sie sich nicht lange wehren
können…
Für KW 26: Haken - L-1VE (InsideOut/Sony)
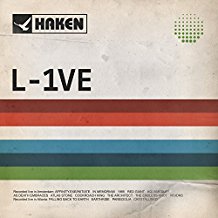 Nach
sechs Alben seit 2008 wird es Zeit für ein Live-Dokument. Und das
kommt zeitgemäß als (Doppel-)CD und DVD in verschiedenen
Formaten und präsentiert eine Band, die auch auf der Bühne
keine Schwächen zeigt. Was bei ihrer komplexen Mischung, die sie
über die Jahre in zunehmender Professionalität kultiviert
haben, durchaus eine Herausforderung ist. Punktgenau sitzen die Breaks
zwischen Progmetal-Power und zarten Piano-Läufen, ergänzen
sich die Songs zwischen Mainstream-Kompatibilität und
Komplexität und begeistern die Kontraste aus harten Gitarren und
melodischem Gesang. Die Briten blicken dabei zurück auf die
Highlights ihrer letzten beiden Alben genauso wie auf ihr
Frühwerk: Mit dem „Aquamedley“ fassen sie ihr
Debütalbum „Aquarius“ von 2010 in einer 22-Minuten
Suite zusammen. Die DVD Version bietet neben dem Konzert zudem in 45
Minuten 3 weitere Songs der Band sowie den Mike Portnoy-Gastauftritt
mit dem 20-minütigen „Crystallised“ vom Prog Power in
Atlanta 2016!
Nach
sechs Alben seit 2008 wird es Zeit für ein Live-Dokument. Und das
kommt zeitgemäß als (Doppel-)CD und DVD in verschiedenen
Formaten und präsentiert eine Band, die auch auf der Bühne
keine Schwächen zeigt. Was bei ihrer komplexen Mischung, die sie
über die Jahre in zunehmender Professionalität kultiviert
haben, durchaus eine Herausforderung ist. Punktgenau sitzen die Breaks
zwischen Progmetal-Power und zarten Piano-Läufen, ergänzen
sich die Songs zwischen Mainstream-Kompatibilität und
Komplexität und begeistern die Kontraste aus harten Gitarren und
melodischem Gesang. Die Briten blicken dabei zurück auf die
Highlights ihrer letzten beiden Alben genauso wie auf ihr
Frühwerk: Mit dem „Aquamedley“ fassen sie ihr
Debütalbum „Aquarius“ von 2010 in einer 22-Minuten
Suite zusammen. Die DVD Version bietet neben dem Konzert zudem in 45
Minuten 3 weitere Songs der Band sowie den Mike Portnoy-Gastauftritt
mit dem 20-minütigen „Crystallised“ vom Prog Power in
Atlanta 2016!
Für KW 25: Blackout Problems - KAOS (Munich Warehouse / Cargo Records)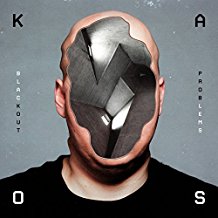
Zwei Jahre nach ihrem Debüt „Holy“ kommen die Münchener mit einem Album von atemberaubender Professionalität. Musikalisch zwischen Alternative Rock und Post-Hardcore präsentieren sie sich damit als deutsches Gegenstück zu Biffy Clyro. Packende Hooklines paaren sich mit mitreißender Energie, spannenden Arrangements und abwechslungsreichem Songwriting. Größtenteils noch Rock-orientierter als ihre schottischen Kollegen mittlerweile geworden sind, zeigen sie mit Songs wie „Holly“ und "Charles", dass sie durchaus auch in der Lage sind, mal ein, zwei Gänge zurückzuschalten. Schwachpunkte gibt es auf KAOS keine, dafür aber gleich einen ganzen Stapel potentieller Hits. Diese Band sollte man im Auge behalten!
Für KW 24: Abay - Love & Distortion (Lovers & Friends / Alive)
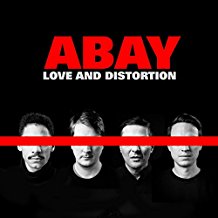 Während der Norden wegen ihres einzigen Deutschlandkonzertes in
Hamburg über die Foo Fighters redet, flattert mir das neue Abay
Album auf den Tisch. Liegt es an der Koinzidenz, dass mir Parallelen in
den Sinn kommen? Stimmlich sollte man Dave Grohl und Aido Abay lieber
nicht vergleichen, da zöge der Letztgenannte den Kürzeren,
aber musikalisch kann das neue Abay-Album locker mithalten. Wobei auch
hier ein Vergleich gar nicht nötig ist, denn Abay hat mit
Blackmail und Ken längst ausreichend Duftmarken hinterlassen, um
sich nicht über andere Größen definieren zu
müssen. Aber seine Mischung aus unwiderstehlichen Hooklines und
wiederholt eingestreuten wuchtigen Gitarrenparts hält jedem
Vergleich stand. Songs, die anfangs an die besten Momente von Fools
Garden erinnern, verwandeln sich im weiteren Verlauf mithilfe des
Saxsolos von Christoph Clöser entweder zum loungigen Jazzsong
(Lemonade) oder, was wesentlich häufiger der Fall ist, zum
Rock-Monster (Rhapsody in Red, Stop the Fever, Lusic Peel, In Transit,
…). Besondere Beachtung verdient auch das
Frank-Bobby-Brown-Zappa-Zitat in „Plastic“, verpackt in
einen Single-tauglichen Hit. Kurz: Das zweite Album unter eigenem Namen
ist eine Box voll funkelnder Diamanten, die man gehört haben
sollte!
Während der Norden wegen ihres einzigen Deutschlandkonzertes in
Hamburg über die Foo Fighters redet, flattert mir das neue Abay
Album auf den Tisch. Liegt es an der Koinzidenz, dass mir Parallelen in
den Sinn kommen? Stimmlich sollte man Dave Grohl und Aido Abay lieber
nicht vergleichen, da zöge der Letztgenannte den Kürzeren,
aber musikalisch kann das neue Abay-Album locker mithalten. Wobei auch
hier ein Vergleich gar nicht nötig ist, denn Abay hat mit
Blackmail und Ken längst ausreichend Duftmarken hinterlassen, um
sich nicht über andere Größen definieren zu
müssen. Aber seine Mischung aus unwiderstehlichen Hooklines und
wiederholt eingestreuten wuchtigen Gitarrenparts hält jedem
Vergleich stand. Songs, die anfangs an die besten Momente von Fools
Garden erinnern, verwandeln sich im weiteren Verlauf mithilfe des
Saxsolos von Christoph Clöser entweder zum loungigen Jazzsong
(Lemonade) oder, was wesentlich häufiger der Fall ist, zum
Rock-Monster (Rhapsody in Red, Stop the Fever, Lusic Peel, In Transit,
…). Besondere Beachtung verdient auch das
Frank-Bobby-Brown-Zappa-Zitat in „Plastic“, verpackt in
einen Single-tauglichen Hit. Kurz: Das zweite Album unter eigenem Namen
ist eine Box voll funkelnder Diamanten, die man gehört haben
sollte!
Für KW 23: Twelfth Night - Fact And Fiction - The Definitive Edition (Festival Music)
 Twelfth Night gehörten zu den Bands, die den Progressivrock in
den 80ern am Leben erhalten haben – neben Bands wie Marillion,
Pallas, IQ und Pendragon. Mit Geoff Mann als Frrontmann hatten die
Briten ihre kreativste und progressivste Phase, von den drei mit ihm
veröffentlichten Alben zwischen 1981 und 84 gilt das vorliegende
als der Klassiker der Band. Die „Definite Edition“
beinhaltet das Original inklusive aller Aufnahmen aus der Zeit, die es
nicht alle auf die damalige Veröffentlichung geschafft haben. So
werden aus den ursprünglichen 8 plötzlich 12 Songs. CD 2
beinhaltet Demos und Live-Versionen aus der Zeit, die den
Entstehungsprozess der Songs verdeutlichen – großteils
bislang unveröffentlicht – sowie eine 2012er Live-Aufnahme
von „Creepshow“. Auf CD 3 gibt es alle acht Songs des Originalalbums
noch einmal in neuen Versionen von Freunden und Weggefährten, wie
man so schön sagt: Mark Spencer, Tim Bowness, Clive Nolan,
Galahad, Pendragon, Alan Reed, die Eh Geoff Mann Band und weitere
Aufnahmen unterstreichen die Bedeutung dieses Albums, das mit dieser
Veröffentlichung eine adäquate Würdigung erhält.
Twelfth Night gehörten zu den Bands, die den Progressivrock in
den 80ern am Leben erhalten haben – neben Bands wie Marillion,
Pallas, IQ und Pendragon. Mit Geoff Mann als Frrontmann hatten die
Briten ihre kreativste und progressivste Phase, von den drei mit ihm
veröffentlichten Alben zwischen 1981 und 84 gilt das vorliegende
als der Klassiker der Band. Die „Definite Edition“
beinhaltet das Original inklusive aller Aufnahmen aus der Zeit, die es
nicht alle auf die damalige Veröffentlichung geschafft haben. So
werden aus den ursprünglichen 8 plötzlich 12 Songs. CD 2
beinhaltet Demos und Live-Versionen aus der Zeit, die den
Entstehungsprozess der Songs verdeutlichen – großteils
bislang unveröffentlicht – sowie eine 2012er Live-Aufnahme
von „Creepshow“. Auf CD 3 gibt es alle acht Songs des Originalalbums
noch einmal in neuen Versionen von Freunden und Weggefährten, wie
man so schön sagt: Mark Spencer, Tim Bowness, Clive Nolan,
Galahad, Pendragon, Alan Reed, die Eh Geoff Mann Band und weitere
Aufnahmen unterstreichen die Bedeutung dieses Albums, das mit dieser
Veröffentlichung eine adäquate Würdigung erhält.
Für KW 22: Kino - Radio Voltaire (InsideOut/Sony)
 Kino
war seinerzeit ein erster Schritt in Richtung It Bites, dem durch die
überraschende anschließende Wiederbelebung von It Bites die
Legitimation wieder entzogen wurde. wie John Mitchell seinerzeit selbst
sagte, dass beide Projekte nebeneinander wenig Sinn machen würde.
Nun mag jeder für sich schlussfolgern, was diese
Kino-Rückkehr für die Zukunft von It Bites heißen
könnte, aber überbewerten müssen wir diesen Schritt
nicht. Die feine Trennlinie zwischen beiden Bands hatte Mitchell
schließlich 2015 mit der Gründung des Projekts Lonley Robot
ohnehin komplett verwischt. Umso überraschender, dass der Name
Kino nun doch wieder auftaucht – und letzten Endes v.a. in der
Personalie von Pete Trewawas begründet. Mit dem sind die Songs
nämlich größtenteils entstanden, während Kino-
(und It Bites-)Keyboarder John Beck mehr oder weniger Gast auf dem
Album ist. Auch Drummer Chris Maitland ist nicht mit an Bord- er war
schon zum Ende des ersten Albums inoffiziell ausgestiegen. Für ihn
ist Mitchells Langzeit-Sideman Craig Blundell mit an Bord. Also auch
hier eine leichte Verschiebung der Personalien. Bleibt die Frage, wie
das Ergebnis dieser neuerlichen Zusammenarbeit ausgefallen ist. Mit
„The Dead Club“, „Out of Time“ und
„Silent Fighter Pilot“ sind ihnen drei echte Highlights
gelungen, “I won`t break” und “Gray Shapes”
sind zudem heimliche und echte Hits des Albums (natürlich nicht im
radio-/kommerziellen Sinn). Ansonsten, so sagt Mitchell selbst, ist
„Radio Voltaire“ eine Sammlung von Pop Songs, denen sie
etwas angetan haben. Das war mal mehr, mal weniger erfolgreich,
offenbart die ein oder andere – für Mitchell-Songs
überraschende – Schwäche. Soll heißen, sein
bestes Album ist es nicht, schlägt den Großteil
der Konkurrenz aber trotzdem um Längen!
Kino
war seinerzeit ein erster Schritt in Richtung It Bites, dem durch die
überraschende anschließende Wiederbelebung von It Bites die
Legitimation wieder entzogen wurde. wie John Mitchell seinerzeit selbst
sagte, dass beide Projekte nebeneinander wenig Sinn machen würde.
Nun mag jeder für sich schlussfolgern, was diese
Kino-Rückkehr für die Zukunft von It Bites heißen
könnte, aber überbewerten müssen wir diesen Schritt
nicht. Die feine Trennlinie zwischen beiden Bands hatte Mitchell
schließlich 2015 mit der Gründung des Projekts Lonley Robot
ohnehin komplett verwischt. Umso überraschender, dass der Name
Kino nun doch wieder auftaucht – und letzten Endes v.a. in der
Personalie von Pete Trewawas begründet. Mit dem sind die Songs
nämlich größtenteils entstanden, während Kino-
(und It Bites-)Keyboarder John Beck mehr oder weniger Gast auf dem
Album ist. Auch Drummer Chris Maitland ist nicht mit an Bord- er war
schon zum Ende des ersten Albums inoffiziell ausgestiegen. Für ihn
ist Mitchells Langzeit-Sideman Craig Blundell mit an Bord. Also auch
hier eine leichte Verschiebung der Personalien. Bleibt die Frage, wie
das Ergebnis dieser neuerlichen Zusammenarbeit ausgefallen ist. Mit
„The Dead Club“, „Out of Time“ und
„Silent Fighter Pilot“ sind ihnen drei echte Highlights
gelungen, “I won`t break” und “Gray Shapes”
sind zudem heimliche und echte Hits des Albums (natürlich nicht im
radio-/kommerziellen Sinn). Ansonsten, so sagt Mitchell selbst, ist
„Radio Voltaire“ eine Sammlung von Pop Songs, denen sie
etwas angetan haben. Das war mal mehr, mal weniger erfolgreich,
offenbart die ein oder andere – für Mitchell-Songs
überraschende – Schwäche. Soll heißen, sein
bestes Album ist es nicht, schlägt den Großteil
der Konkurrenz aber trotzdem um Längen!
Für KW 21: Subsignal - La Muerta (Gentle Art Of Music/Soulfood)
Auch mit ihrem neuen Album haben es sich die Münchener komfortabel eingerichtet zwischen AOR und Prog, gehen es mal straighter an, mal vertrackter, immer darauf bedacht, einen gewissen Level an Anspruch nicht zu unter- oder zu überschreiten. Der Song steht im Mittelpunkt, die Arrangements und Beigaben halten das Album abwechslungsreich. Und genau das ist das Geheimnis der vier Musiker plus Sänger Arno Menses: Sie agieren auf einem äußerst professionellen Level, was die Qualität ihrer Beiträge betrifft, geben aber ihr Herzblut und leben ihre Musik. Und deswegen fällt es so schwer, sich ihrem Abwechslungsreichtum von Rock, Pop und Prog zu entziehen. Hin und wieder erinnert das ein wenig an Yes zu 90125-Zeiten, aber hier Vergleiche zu ziehen, scheint ob der Vielfalt des Albums fast vermessen. Ein dolles Ding!
Für KW 20: Spocks Beard - Noise Floor (InsideOut / Sony)
 Das
Gute an einer Band ist, dass sie in der Regel mehr ist als die Summer
ihrer Teile, sprich Mitglieder. Bei Spocks schien das optimale
Gleichgewicht für eine Weile gestört, aber mit dem Einstieg
von Ted Leonard haben sie zur an alte Genialität grenzenden
Kompositionskunst wieder zurückgefunden. Schon das erste Album, an
dem der ex-(?)Enchant Sänger beteiligt war, „Brief Nocturnes
and Dreamless Sleep“ (2013) war eine deutliche Steigerung, das
anschließende „The Oblivion Particle“ (2015) ein
kleines Meisterswerk der Band. Mit „Noise Floor” gelingt es
den Kaliforniern, daran weiter anzuschließen. Mit bemerkenswertem
Abwechslungsreichtum und auf beachtlichem Niveau glänzen sie
einmal mehr mit ihren Stärken, dieser optimal austarierten
Mischung aus guten Hooklines, verspielt-progressiven Passagen und
melodisch-bombastischer Spannungsentladung – beginnend mit dem
furiosen Opener “To Breathe Another Day” und
abschließend mit dem Highlight „Beginnings“. Wobei
Abschluss nicht einmal zutreffend ist, weil es noch eine CD2 gibt, die
ein paar Songs hinterher schiebt, die die jüngste Erkenntnis der
Band, dass der Song, nicht so sehr das technische Drumherum im
Mittelpunkt steht. Songs, die offenbar nicht mehr aufs, bzw. zum Album
passten und die weit mehr sind, als eine kleine Zugabe. Klasse!
Das
Gute an einer Band ist, dass sie in der Regel mehr ist als die Summer
ihrer Teile, sprich Mitglieder. Bei Spocks schien das optimale
Gleichgewicht für eine Weile gestört, aber mit dem Einstieg
von Ted Leonard haben sie zur an alte Genialität grenzenden
Kompositionskunst wieder zurückgefunden. Schon das erste Album, an
dem der ex-(?)Enchant Sänger beteiligt war, „Brief Nocturnes
and Dreamless Sleep“ (2013) war eine deutliche Steigerung, das
anschließende „The Oblivion Particle“ (2015) ein
kleines Meisterswerk der Band. Mit „Noise Floor” gelingt es
den Kaliforniern, daran weiter anzuschließen. Mit bemerkenswertem
Abwechslungsreichtum und auf beachtlichem Niveau glänzen sie
einmal mehr mit ihren Stärken, dieser optimal austarierten
Mischung aus guten Hooklines, verspielt-progressiven Passagen und
melodisch-bombastischer Spannungsentladung – beginnend mit dem
furiosen Opener “To Breathe Another Day” und
abschließend mit dem Highlight „Beginnings“. Wobei
Abschluss nicht einmal zutreffend ist, weil es noch eine CD2 gibt, die
ein paar Songs hinterher schiebt, die die jüngste Erkenntnis der
Band, dass der Song, nicht so sehr das technische Drumherum im
Mittelpunkt steht. Songs, die offenbar nicht mehr aufs, bzw. zum Album
passten und die weit mehr sind, als eine kleine Zugabe. Klasse!
Für KW 19: Yesternight - The False Awakening (12Sounds Production)
Arena, das Role-Model des zeitgemäßen Brit-Progs zwischen
klassischen, bombastischen Melodikpassagen und mode3rnem Rock-Ansatz,
hat gerade ein neues Album angekündigt, da grätschen die
polnischen Yesternight in die Parade. Mit einem Album, das genau in das
gerade skizzierte Bild passt. Mit atmosphärischem Beginn, einem
kräftigen Auftakt, viel Abwechslung und genausop viel klassischen
Elementen mäandern die zwischen Arena, Subsignal, Porcupine Tree
und vielen anderen prominenten Vertretern der aktuellen ersten Progliga.
Drummer Kamil Kluczynski spielt nebenbei auch noch bei den Kollegen von
Art of Illusion deren aktuelles Album „Cold War of
Solipsism“ (12Sounds Production) nach anfänglich
härterem Ansatz a la Ayreon im weiteren Verlauf auch nicht so weit
von der Musik Yesternights einpendelt… ein spannendes Doppel aus
dem Nachbarland also!
Für KW 18: Frank Turner - Be More Kind 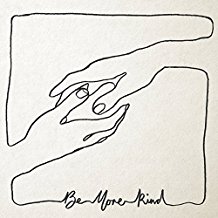 (Polydor Records)
(Polydor Records)
Und plötzlich ist er everybody`s darling! Jeder kennt seinen Namen, es ist hip, seine Musik zu kennen und uncool, keines seiner Alben zu besitzen. Dafür bedakt er sich artig mit einem neuen Stapel Songs voll wundervoller Melodien und Hooklines. Den alten Punkrocker lässt er dabei kaum noch durchblitzen, nur in „1933“ klingt er dabei wie eine Mischung aus The Alarm und New Model Army – die auch mal hip waren. Aber das waren die 80er. Ansonsten beweist Frank Turner 2018 im Großteil der Songs seine Nähe zu Counting Crows-College Pop/Rock/Singer/Songwriting, bei dem sich auch die wiederholten stimmlichen Ähnlichkeiten zu Adam Duritz ihren Weg suchen. Textlich deutet er seine Bissigkeit zumindest an, wie in „Make America Great Again“, unterlegt allerdings mit Diskorhythmen. Am besten ist er aber mittlerweile in großartigen Liebeserklärungen der Marke „There she is“. Ein schönes Album!
Live:: Am 13.11.2018 in Bremen - Aladin
Für KW 17: Toundra - Vortex (InsideOut/Sony )
Mit schöner Regelmäßigkeit legen die Spanier ein
neues Album vor und müssen sich und ihren Fans längst schon
nichts mehr beweisen. Gerade ihr letztes Album führte sie mit 150
Shows durch die ganze Welt – naja zumindest 18 Länder davon
– wurde Album des Jahres im spanischen Mondosonoro Magazin;
für ihr neues Album sind sie vom Sublabel Superball zu
InsideOut „aufgestiegen“.
2008-10-12-15 erschienen die Alben I, II, III und IV, nach
„IV“ war es auch bei Led Zeppelin vorbei mit dem
Zählen, nun wird es Zeit für „richtige
Albumnamen“. Wobei es ihnen schon wichtig war, dass es mit
„V“ losgeht. Das sind Probleme… Aber was will man
machen, wenn sich aus den Albumthemen eben kein Titel automatisch
ergibt? Und die Themen sind bei instrumentalen Alben nun einmal
subjektiv.
Von der musikalischen Grundausrichtung haben sie nicht dramatisch viel
verändert: Postrock im Stile Mogwais/Monos/Long Distance Callings,
mal lauter, oft auch leiser, aber nie gleich, mit grandiosen
Steigerungen, Breaks, Wechsel und endlosen Soli. Fans dieses Genres
sollten sie auf dem Schirm haben!
Für KW 16: A Perfect Circle - Eat The Elephant (Warner / ADA)
 Es
mag an der Mixtur der Herkunft ihrer Protagonisten aus Bands wie Tool,
Queens of a Stone Age und Primus liegen oder auch an ihrer
stilistischen Wandelbarkeit, dass diese Band so schwer zu fassen - oder
schlicht an ihrer Vielfalt. NuAlternativeGothicArtRock wäre ein
Versuch, einen Teil ihrer musikalischen Geschichte zusammenzufassen.
Und doch muss man sich für das neue Album einmal mehr auf ein
komplett neues Hörerlebnis einstellen.
Es
mag an der Mixtur der Herkunft ihrer Protagonisten aus Bands wie Tool,
Queens of a Stone Age und Primus liegen oder auch an ihrer
stilistischen Wandelbarkeit, dass diese Band so schwer zu fassen - oder
schlicht an ihrer Vielfalt. NuAlternativeGothicArtRock wäre ein
Versuch, einen Teil ihrer musikalischen Geschichte zusammenzufassen.
Und doch muss man sich für das neue Album einmal mehr auf ein
komplett neues Hörerlebnis einstellen.
Erstaunlich ruhig und atmosphärisch, bisweilen fast experimentell
dürfte dieses Werk mangels Extreme kaum einem Rock-nicht-Metal-Fan
vor den Kopf stoßen. Spannend arrangiert, mit unterhaltsamer
Abwechslung und ein paar tollen Melodiebögen und Songs können
die Amerikaner mit ihrem vierten Album einmal mehr überzeugen. 14
Jahre nach ihrem letzten Album brauchten sie ohnehin nicht mehr
irgendwo anzuknüpfen. Entsprechend beginnen sie mit fast jazzigem
Schagzeug und einem Sound zwischen The Cure und Depeche Mode und
schauen in der Folge bei Radiohead, Dredg und Anathema vorbei und legen
ein Album vor, das einen mal wieder eine Weile beschäftigt
hält und auf dem man immer wieder Neues entdecken kann. Ganz ohne
Skandal, meist erstaunlich soft und entspannt – und doch immer
wieder begeisternd.
Für KW 15: Island - Feels Like Air (Frenchkiss Records)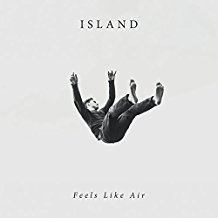
Ihre Plattenfirma möchte sie als Alternative Rock Band verkaufen - aber wenn das in einer Liga mit Creed und Three Doors Down läuft, dann stimmt der Titel: Dann sind Island leicht wie Luft. Aber wunder-wunderschön! Entspannter, melodischer Rock mit einem latenten Rock-Ansatz, der hier und da durchblitzt aber insgesamt eine so warme Ruhe ausstrahlt, dass man sich auf der Stelle in ihren Sound verliebt. Die wichtigsten Zutaten sind exzellentes Songwriting, das jeden Song zum Schmuckstück macht, und die herrlich raue Stimme von Frontmann und Songwriter Rollo Doherty, der für die Extraportion Rock sorgt. Rein musikalisch ist von Rock hier aber kaum zu sprechen. Dezente Steigerungen ins Schnellere, wie in "Moth", "We Can Go Anywhere" und "God Forgive" sind (gern genommene) Ausnahmen, aber kaum geeignet, den schwebenden Soundkosmos ernsthaft ins Wanken zu bringen. Die Foals, Bombay Bicycle Club und die Kings of Leon führen ihre Fürsprecher noch mit ins Feld - und in der Tat können Island da stimmlich und kompositorisch locker mithalten. Was die Arrangements betrifft, wünscht man sich in Zukunft vielleicht noch ein wenig mehr Abwechslung.
Für KW 14: Deafening Opera - Let Silence Fall (RecordJet / Soulfood)
 Kein
Album für eine Nacht! Mit Deafening Opera schickt ich ein neuer
Fünfer an, ins Geschehen der deutschen Progszene einzugreifen. Und
was sie hier auftischen, ist ein spannender Anfang und eine
Wundertüte voller Ideen. Nicht immer optimal umgesetzt, aber
dafür umso abwechslungsreicher.
Kein
Album für eine Nacht! Mit Deafening Opera schickt ich ein neuer
Fünfer an, ins Geschehen der deutschen Progszene einzugreifen. Und
was sie hier auftischen, ist ein spannender Anfang und eine
Wundertüte voller Ideen. Nicht immer optimal umgesetzt, aber
dafür umso abwechslungsreicher.
Ein Album, an dem man immer wieder herumkritteln könnte, weil es
immer wieder mal an der Ideallinie vorbeikomponiert ist – aber
man kann auch einfach den Abwechslungsreichtum hervorheben und sich
über ein tolles Album freuen, das ganz viele tolle Momente und
Songs hat, das angstlos die Stimmungen und Stile wechselt und
ständig mit neuen Überraschungen aufwartet.
Sänger Adrian Daleore ist kein Spitzensänger, aber auch er
hat viele verschiedene Seiten und agiert variationsreich und ohne
Schwachstellen. Everon ist eine Referenz, die mir öfter in den
Sinn kommt, und da bei denen ja Funkstille ist, kann man Deafening
Opera dem geneigten Fan also bedenkenlos empfehlen. Aber auch Sylvan
oder Ulysses könnte man hier als weitere (deutsche) Namen ins Feld
führen – letzten Endes sind sie eigenständig genug, um
nicht auf derlei Vergleiche angewiesen zu sein.
Für KW 13: Phi - Cycles (Gentle Art Of Music / Soulfood)
Schon ihr Vorgängeralbum hatte mich begeistert, jetzt hat das ehemalige österreichische Trio, mittlerweile Quartett um Mastermind Markus Bratusa erneut zugeschlagen. Und auf der Suche nach dem „goldenen Schnitt“ aus Rock n‘ Roll und künstlerischem Anspruch erneut einen Schritt nach vorne gemacht. Dieses Album wird spannender mit jedem Lied– dabei fängt es mit der ersten Single, dem Opener „Children of the Rain“ bereits klasse an – und mit jedem Hören. Denn die Fülle an Details und perfekt eingesetzter Komplexität bringt immer wieder neue Feinheiten zutage, ohne dass man dieses Album nur kopfbesetzen Proghörern empfehlen möchte, denn die 6 Songs sind trotz Liedlängen von knapp 7 bis knapp 9 Minuten jederzeit eingängig und mitreißend. Dazu ist Bratusa ein toller Sänger! Er könnte spielend auch Pop singen, wechselt dann spielend in eine mächtige Metal-Röhre, was für zusätzliche Spannung sorgt. Ich hatte lange kein Album mehr, das es so lange bei ir im Auto – eigentlich eher der Ort, um neue Platten durchzuhören – ausgehalten hat, bzw. den Platz besetzt hat. „Cycles“ ist die perfekte Mischung aus Härte und Melodie, Komplexität und Eingängigkeit.
Für KW 12: Monster Magnet - Mindfucker (Universal Music)
 Kapp
dreißig Jahre lang sind die Jungs aus New Jersey schon unterwegs
– zugegeben nicht immer in gleicher Besetzung, aber Sänger
und Gitarrist Dave Wyndorf hat das Schiff ganz gut auf Kurs gehalten.
Auf seinem Kurs, versteht sich. Und der war zwischen Stoner Rock,
Psychedelic Rock, Space Rock und Hard Rock schon am Anfang ihrer
holprigen Karriere breit genug. Mit zunehmendem Erfolg wurde der
verschwurbelte Einfluss bewusstseinserweiternder Mittel und
musikalischer Themen zwar geringer und die Musik rockiger, aber ihren
eigenen Stil hat Wyndorf nie verraten. Trotzdem kann man dem neuen
Album eine gewisse neue Linie zusprechen. Wyndorf spricht von seinem
„rock-for-rock’s-sake album“, das er so noch nie
gemacht habe. Und das musikalisch dank aktueller Besetzung leichter und
begeisternder von der Hand ging, als jemals zuvor. Lediglich und just,
als er sich an die Texte machen wollte, erfuhr Amerika mit der
Amtseinführung Donald Trumps einen so unglaublichen Wandel, dass
er vom Gute-Laune-Kurs ein wenig abwich. Was der Qualität dieses
Albums offensichtlich nicht geschadet hat. Denn abgesehen vom
Albumtitel sind ein paar scharfzüngige Texte entstanden sind, die
Wyndorf als intelligenten Zeitkritiker zeigen.
Kapp
dreißig Jahre lang sind die Jungs aus New Jersey schon unterwegs
– zugegeben nicht immer in gleicher Besetzung, aber Sänger
und Gitarrist Dave Wyndorf hat das Schiff ganz gut auf Kurs gehalten.
Auf seinem Kurs, versteht sich. Und der war zwischen Stoner Rock,
Psychedelic Rock, Space Rock und Hard Rock schon am Anfang ihrer
holprigen Karriere breit genug. Mit zunehmendem Erfolg wurde der
verschwurbelte Einfluss bewusstseinserweiternder Mittel und
musikalischer Themen zwar geringer und die Musik rockiger, aber ihren
eigenen Stil hat Wyndorf nie verraten. Trotzdem kann man dem neuen
Album eine gewisse neue Linie zusprechen. Wyndorf spricht von seinem
„rock-for-rock’s-sake album“, das er so noch nie
gemacht habe. Und das musikalisch dank aktueller Besetzung leichter und
begeisternder von der Hand ging, als jemals zuvor. Lediglich und just,
als er sich an die Texte machen wollte, erfuhr Amerika mit der
Amtseinführung Donald Trumps einen so unglaublichen Wandel, dass
er vom Gute-Laune-Kurs ein wenig abwich. Was der Qualität dieses
Albums offensichtlich nicht geschadet hat. Denn abgesehen vom
Albumtitel sind ein paar scharfzüngige Texte entstanden sind, die
Wyndorf als intelligenten Zeitkritiker zeigen.
Für KW 11: Black Foxxes - Reiði (Spinefarm Records)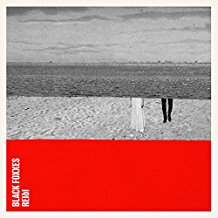
Nachschub aus Exeter und erneut treffen Mark Holley, Tristan Jane und Ant Thornton absolut ins Schwarze! Bereits ihr Debütalbum "I´m not well" (vgl. CD der Woche 34/2016) war die perfekte Balance aus Indie-Rock und Post-HC, immer mit der nötigen Prise Drama, Verzweiflung und Leidenschaft. Mit dem neuen Album entdecken sie auch vermehrt die sanfteren Töne für sich, z.B. in der ersten Single "Saela" mit nur dezenter Härte. Hier und da sind sie sogar in relativ ruhigen Regionen unterwegs, in anderen Songs geizen sie aber auch nicht mit gelegentlichen Ausflügen in Extreme und begeisternden Steigerungen – ohne so heftig zu werden, um wirklich zu polarisieren. Placebo und Alberta Cross sind zwei Namen, die ich hier nennen möchte, wobei das Soundspektrum bei den Black Foxxes noch größer ist. Der Albumtitel mutet isländisch an – und in der Tat unternahm Holley einen ausgiebigen Trip nach Island, um seine Visionen zu untermauern. Das Ergebnis ist, verglichen mit dem Debüt, in dem er seine Verzweiflung mit seiner Morbus Chron-Erkrankung offen zur Schau stellte, deutlich positiver ausgefallen. Was der Qualität seiner Songs aber keinen Abbruch tut. Ein weiteres exzellentes Album!
Live: 12.4.18 Köln – Jungle, 13.4. Hamburg – Headcrash, 15.4. Berlin – Blaues Zimmer
Für KW 10: Broken Witt Rebels - Broken Witt Rebels (Snakefarm Records/Caroline-Universal)
 Ist
das noch Blues Rock? Oder sollte ich fragen, ist das schon Blues Rock?
Diese Newcomer aus Birmingham spielen Rock – und haben ein echtes
Pfund am Mikro: Danny Core klingt original wie Kings of
Leon-Sänger Caleb Followill – und mit melodischen Rock, egal
wie Blues-infiziert oder nicht und dieser Röhre am Mikro kann man
schon wenig daran ändern, an die Kings of Leon zu denken. Was aber
nicht weiter stört! Denn abgesehen davon, dass deren letztes Album
ja auch schon wieder knapp zwei Jahre alt ist, finden deren Konzerte
längst in Hallen- und Stadiengrößen statt, deren Besuch
längst nicht mehr jedermanns Sache ist. Also muss da wohl mal was
Neues her! Und da kommen die Broken Witt Rebels gerade recht. Mit ihrer
Mischung aus Blues, Soul und Rock sind sie eigenständig genug, um
– trotz der Stimme – nicht als Kopie durchgehen zu
müssen, Gitarrist James Tranter lickt nebenbei wie U2s The Edge
und auch sonst machen sie vieles richtig. 2016 heimsten sie bereits den
Preis "Unsigned Rock Band des Jahres" bei den Unsigned Music Awards in
London ein, jetzt ist es soweit. Das vorliegende Debütalbum
entstand mit Tom Gittins (u.a. Robert Plant) und fasst die EPs der Band
mit vier neuen Songs zusammen. Ein klasse Werk: Abwechslungsreicher
Rock ohne Schwachpunkt. I love it!
Ist
das noch Blues Rock? Oder sollte ich fragen, ist das schon Blues Rock?
Diese Newcomer aus Birmingham spielen Rock – und haben ein echtes
Pfund am Mikro: Danny Core klingt original wie Kings of
Leon-Sänger Caleb Followill – und mit melodischen Rock, egal
wie Blues-infiziert oder nicht und dieser Röhre am Mikro kann man
schon wenig daran ändern, an die Kings of Leon zu denken. Was aber
nicht weiter stört! Denn abgesehen davon, dass deren letztes Album
ja auch schon wieder knapp zwei Jahre alt ist, finden deren Konzerte
längst in Hallen- und Stadiengrößen statt, deren Besuch
längst nicht mehr jedermanns Sache ist. Also muss da wohl mal was
Neues her! Und da kommen die Broken Witt Rebels gerade recht. Mit ihrer
Mischung aus Blues, Soul und Rock sind sie eigenständig genug, um
– trotz der Stimme – nicht als Kopie durchgehen zu
müssen, Gitarrist James Tranter lickt nebenbei wie U2s The Edge
und auch sonst machen sie vieles richtig. 2016 heimsten sie bereits den
Preis "Unsigned Rock Band des Jahres" bei den Unsigned Music Awards in
London ein, jetzt ist es soweit. Das vorliegende Debütalbum
entstand mit Tom Gittins (u.a. Robert Plant) und fasst die EPs der Band
mit vier neuen Songs zusammen. Ein klasse Werk: Abwechslungsreicher
Rock ohne Schwachpunkt. I love it!
Für KW 9: The Temperance Movement - A Deeper Cut (Earache/Warner)
Was für ein tolles Album! Rock, Pop, Blues, bisweilen auch ein
wenig Kante – und das so spielend miteinander vermischt,
dass man kein ausgewiesener Fan von irgendeiner bestimmten dieser
Spielarten sein muss – womit die Briten sich hier eine Menge
Freunde machen dürften! Das trifft sich gut, denn nach
ausgiebuigem Touren mit den Rolling Stones dürften eine Menge
Menschen auf sie neu aufmerksam geworden sein. Ihr drittes Album
könnte also nicht das berühmte schwierigste werden, sondern
in der Tat jetzt den großen Wurf landen. Sänger Phil
Campbell (trotz Namensgleichheit NICHT nebenbei der
Motörhead-Gitarrist!) erinnert wiederholt stark an Kelly Jones von
den Stereophonics und auch musikalisch sind die Londoner nicht
meilenweit von ihren Landsleuten entfernt.
Live zu erleben: 18.3.2018 München – Backstage, 24.03. Berlin
– Lido, 25.03. Hamburg – Knust, 27.03. Köln –
Stollwerk.
Für KW 8: The Front Bottoms - Going Grey (Warner Music)
 “Holy
Fuck, I´m about to die….“ diese Textzeile im Opener
ist schonmal ein ear-catcher, wenn man das mal so ausdrücken kann.
Das Ganze verpackt in eine coole Mischung aus Rock und
Singer/Songwriter, das macht schon Spaß. Im weiteren Verlauf
wird’s vereinzelt auch mit Pop-igeren Anteilen angereichert, das
ist schon recht kurzweilig. Das Duo The Front Bottoms aus New
Jersey, das mittlerweile ein Trio ist spätestens mit ihrem letzten
Album „Back On Top” aufgefallen, für das sie ein
relativ großes Medienecho bekamen – mit entsprechend
großen Tourneen und Festivalauftritten. „Going Grey" ist
ihr sechstes Album, mit dem sie sich im Februar in Deutschland
vorgestellt haben, produziert von der Band selbst sowie Nick Furlong,
der auch schon für Blink 182 und Papa Roach gearbeitet hat. Eine
überzeugende Vorstellung, der zur weiteren Verbreitung allerdings
der richtige Hit fehlt, fürchte ich. (Und mit der Eingangs
erwähnten Textzeile wird das im Radio schon mal nichts...)
“Holy
Fuck, I´m about to die….“ diese Textzeile im Opener
ist schonmal ein ear-catcher, wenn man das mal so ausdrücken kann.
Das Ganze verpackt in eine coole Mischung aus Rock und
Singer/Songwriter, das macht schon Spaß. Im weiteren Verlauf
wird’s vereinzelt auch mit Pop-igeren Anteilen angereichert, das
ist schon recht kurzweilig. Das Duo The Front Bottoms aus New
Jersey, das mittlerweile ein Trio ist spätestens mit ihrem letzten
Album „Back On Top” aufgefallen, für das sie ein
relativ großes Medienecho bekamen – mit entsprechend
großen Tourneen und Festivalauftritten. „Going Grey" ist
ihr sechstes Album, mit dem sie sich im Februar in Deutschland
vorgestellt haben, produziert von der Band selbst sowie Nick Furlong,
der auch schon für Blink 182 und Papa Roach gearbeitet hat. Eine
überzeugende Vorstellung, der zur weiteren Verbreitung allerdings
der richtige Hit fehlt, fürchte ich. (Und mit der Eingangs
erwähnten Textzeile wird das im Radio schon mal nichts...)
Für KW 7: Listener - Being Empty: Being Filled (Sounds of Subterrania)
Viel besser könnte man kaum starten: Das Album beginnt mit dem Übertrack „Pent Up Genes“ und führt seine sehr eigene und sehr coole Mischung aus harten Gitarren und mal mehr, mal weniger melodischem Sprechgesang über in einen Rock-Track allererster Güte, fetter Sound und Break mit Tempowechsel inklusive. So einen Song mal wieder ihren eigenen nennen zu dürfen, davon dürften Faith No More seit Jahren träumen. So etwas von den Herren um Mike Patton und die Rockwelt hätte ihnen mal wieder zu Füßen gelegen. Listener werden noch ein bisschen weiterstrampeln müssen, um dorthin zu kommen. Zumal ihre Mischung aus megafetten Gitarren zwischen Alternative Rock und NuMetal und megacoolem Gesang zwischen Rap und Screamo als dem Crossover 2.0 doch ein ganz klein bisschen zu abwechslungsarm ist, um auf volle Länge begeistern zu können. Aber mit Post Rock Sounds, die an Bands wie Long Distance Calling erinnern entpuppen sich hier bei genauerem Hinhören einige Highlights nicht nur für Fans von Faith No More, Papa Roach und Crazytown.
Für KW 6: Simple Minds - Walk between the Worlds (BMG)
 Simple
Minds – die Helden meiner Jugend! Mit „Once upon a
time“ schon unsterblich geworden, mit dem nachfolgenden
Live-Album erst recht, wuchsen sie mit „Street Fighting
Years“ sogar noch darüber hinaus. Und auch später (von
den nach und nach entdeckten früheren Alben ganz zu schweigen)
waren sie immer wieder für ein Highlight gut. Aber es gab auch
Tiefschläge. „Néapolis“ war an Belanglosigkeit
kaum zu überbieten – und ließ die Band sogar erstmal
in der kreativen Pause verschwinden, von der sie sich erst Jahre
später, mit einer Rückbesinnung auf frühe Wave-Tage und
vielerorts bejubelten Rückkehr erholten. Das letzte Studioalbum
„Big Music“ war dann allerdings erneut ein Werk, für
das sich so Mancher verwundert den kahler gewordenen Kopf kratzte. Nach
zwischenzeitlichem „Acoustic“-Experiment kommt nun
Labelwechsel und neues Album – aber ohne neuen Kreativschub. Die
bereits seit Jahren vollzogene Hinwendung zum Glitzer-Pop hält an,
die Kompositionen sind mehr Beat als Klasse und auch nach mehrmaligem
Hören des Albums hat man nicht das Gefühl, dass hier neue
Großtaten geschaffen wurden. Sie erinnern abwechselnd an
verschiedene Phasen ihrer Karriere, kopieren sich teilweise selbst und
können dabei leider nicht mit Melodien und Songs glänzen, die
frühere Erfolge wiederholen könnten.
Simple
Minds – die Helden meiner Jugend! Mit „Once upon a
time“ schon unsterblich geworden, mit dem nachfolgenden
Live-Album erst recht, wuchsen sie mit „Street Fighting
Years“ sogar noch darüber hinaus. Und auch später (von
den nach und nach entdeckten früheren Alben ganz zu schweigen)
waren sie immer wieder für ein Highlight gut. Aber es gab auch
Tiefschläge. „Néapolis“ war an Belanglosigkeit
kaum zu überbieten – und ließ die Band sogar erstmal
in der kreativen Pause verschwinden, von der sie sich erst Jahre
später, mit einer Rückbesinnung auf frühe Wave-Tage und
vielerorts bejubelten Rückkehr erholten. Das letzte Studioalbum
„Big Music“ war dann allerdings erneut ein Werk, für
das sich so Mancher verwundert den kahler gewordenen Kopf kratzte. Nach
zwischenzeitlichem „Acoustic“-Experiment kommt nun
Labelwechsel und neues Album – aber ohne neuen Kreativschub. Die
bereits seit Jahren vollzogene Hinwendung zum Glitzer-Pop hält an,
die Kompositionen sind mehr Beat als Klasse und auch nach mehrmaligem
Hören des Albums hat man nicht das Gefühl, dass hier neue
Großtaten geschaffen wurden. Sie erinnern abwechselnd an
verschiedene Phasen ihrer Karriere, kopieren sich teilweise selbst und
können dabei leider nicht mit Melodien und Songs glänzen, die
frühere Erfolge wiederholen könnten.
Gleichzeitig sind sie in ihrer besonderen Kombination aus (grandios
fettem!) Sound und der Stimme Jim Kerrs immer noch in der Lage,
große Momente zu schaffen. Die kulminieren in den Ausnahmen auf
dem Album. „Barrowland Star“ verzichtet erstmals auf
Disko-Beats, Charlie Burchill erinnert daran, dass er auch noch zum
festen Kern der Band gehört und packt ein Gitarrensolo aus (und
für eine Weile auch gar nicht mehr ein!) und erinnert damit fast
an alte Zeiten, zu denen die Simple Minds sogar mal eine Rockband
waren. Leider wird die erste Hälfte des Songs von einer derart
einfachen Schnulzenmelodie geprägt, dass es schwerfällt,
diesen Song zum Highlight zu stilisieren. „Sense of
Discovery“ ist ein weiterer Song über 6 Minuten ohne
Computerdrums und macht „Alive & Kicking“
schüchterne Avancen. Zwei Beispiele, die zeigen, dass sie neben
tollen Sounds durchaus noch anspruchsvolle Arrangements basteln und
dann auch relativ gute Songs produzieren können. Aber während
sich Jim Kerr live immer als großen Fan von „the best
drummer in the world, Mel Gaynor“ ausgab, müssen wir uns
hier größtenteils mit einfachsten Teenie-Disko-Beats
zufrieden geben. Das Ergebnis ist ein lupenreines Pop-Album, teilweise
gut, oft unterhaltsam, meist eher… Simple.
Für KW 5: Rick Springfield - The Snake King (Frontiers)
Die Idee ist reizvoll: Rick Springfield wird erwachsen. Ich meine, das ist es doch, was man(n) mit einem Blues-Album beweisen möchte, oder? Nicht, dass der einstige Sunnyboy nicht auch in der Vergangenheit längst Alben gemacht hat, auf denen er sich von seinen Teenie-Jahren deutlich distanziert hatte. Hemdsärmel-Rock, Alternative-Rock-Kante, das war schon durchaus solide. Live auf der Loreley 2013 hat er das Ganze noch einmal relativiert… mit seinen Gesten und dem Gitarrespielen mit einem Strauß Rosen (!) war das jetzt nicht immer so richtig ernst zu nehmen… aber sympathisch war es allemal. Jetzt also Blues. Warum nicht. Springfield bleibt also immer für eine Überraschung gut. Und vieles auf dem Album ist gar nicht so schlecht – manches sogar richtig gut! Hier und da hat sich auch ein schwächerer Song eingeschlichen, aber vielleicht fehlt mir dazu auch die richtige Blues-Ader. Trotz allem darf bezweifelt werden, dass er sich hiermit eine neue Identität definieren kann.
Rick Springfield "In The Land Of The Blind" (Official Audio)
Für KW 4: Steve Hackett - Wuthering Nights – Live in Birmingham (InsideOut / Sony )
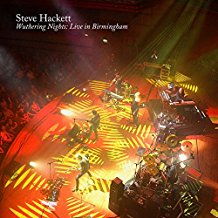 Wie
jetzt? Zu jeder Tour ein neues Live Album? Ja! Warum auch nicht? Die
heutige Technik macht’s möglich. Und wie sein Sänger
Kollege Ray Wilson schöpft auch Steve Hackett aus einem
unendlichen Fundus an Material. Und noch mehr als Wilson stellt
für Hackett jede neue Tour eine neue Möglichkeit zur eigenen
Standortbeschreibung dar. Zur „Re-Arranged
2017“-Nabelschau, sozusagen, bzw., um das 40. Jubiläum
seiner letzten Aufnahme mit Genesis „Wind & Wuthering“
zu feiern, mal einen Schwerpunkt darauf. Außerdem in diesem Jahr
mit „Sax & Flutes“ von Rob Townsend als sehr
schöne und passende neue (!) Elemente, die alten wie neuen Songs
einen interessanten Stempel aufgedrücken. Und nachdem er sich
jahrelang mit eigenen Songs durch die Clubs quälte und erst mit
Genesis Revisited Touren wieder zu größeren Erfolg gelangte,
ist es schön mit anzusehen, wie er sich jetzt und immer mehr auch
wieder eigenem Material widmet. Und auch hier ist der Fundus an
Highlights noch längst nicht ausgeschöpft. Trotzdem fand er
darüber hinaus auch für die letzte Tournee wieder
Genesis-Klassiker, die nicht auf seinen letzten Live Alben zu
hören waren, die aber nicht weniger wertvoll sind – umso
mehr in den neuen Versionen. Leider war die Wahl der Sänger nicht
in jedem Fall optimal, aber ich glaube, da spielt auch ein bisschen der
persönliche Geschmack eine Rolle. Wir sind gespannt zu sehen, ob
nun eher eine neue „Re-Arranged 2018“-Nabelschau erfolgt,
oder aber ein neues Album. Fortsetzung folgt.
Wie
jetzt? Zu jeder Tour ein neues Live Album? Ja! Warum auch nicht? Die
heutige Technik macht’s möglich. Und wie sein Sänger
Kollege Ray Wilson schöpft auch Steve Hackett aus einem
unendlichen Fundus an Material. Und noch mehr als Wilson stellt
für Hackett jede neue Tour eine neue Möglichkeit zur eigenen
Standortbeschreibung dar. Zur „Re-Arranged
2017“-Nabelschau, sozusagen, bzw., um das 40. Jubiläum
seiner letzten Aufnahme mit Genesis „Wind & Wuthering“
zu feiern, mal einen Schwerpunkt darauf. Außerdem in diesem Jahr
mit „Sax & Flutes“ von Rob Townsend als sehr
schöne und passende neue (!) Elemente, die alten wie neuen Songs
einen interessanten Stempel aufgedrücken. Und nachdem er sich
jahrelang mit eigenen Songs durch die Clubs quälte und erst mit
Genesis Revisited Touren wieder zu größeren Erfolg gelangte,
ist es schön mit anzusehen, wie er sich jetzt und immer mehr auch
wieder eigenem Material widmet. Und auch hier ist der Fundus an
Highlights noch längst nicht ausgeschöpft. Trotzdem fand er
darüber hinaus auch für die letzte Tournee wieder
Genesis-Klassiker, die nicht auf seinen letzten Live Alben zu
hören waren, die aber nicht weniger wertvoll sind – umso
mehr in den neuen Versionen. Leider war die Wahl der Sänger nicht
in jedem Fall optimal, aber ich glaube, da spielt auch ein bisschen der
persönliche Geschmack eine Rolle. Wir sind gespannt zu sehen, ob
nun eher eine neue „Re-Arranged 2018“-Nabelschau erfolgt,
oder aber ein neues Album. Fortsetzung folgt.
Für KW 3: The Xcerts - Hold On To Your Heart (Raygun Records)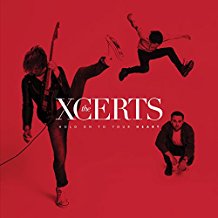
Ihre Bandbreite beweisen die Schotten gleich mal im Doppel, das dieses Album eröffnet. Einer herzerweichenden Pianoballade – was für ein mutiger Anfang für ein Indie-Rock-Album – folgt ein echter Powersong; eine Kombination, die echte Leidenschaft beweist und ein Album eröffnet, mit dem sich der geneigte Hörer direkt zurück in die Achtziger gebeamt fühlt: “Hold On To Your Heart” ist ein kühner Liebesbrief an eine vergangene Ära, von einem sentimentalen hoffnungslosen Romantiker verfasst. Zurück zum „Breakfast Club“, zu Deacon Blue, Tom Petty und Rick Springfield, zu Pop-Hymnen zwischen Kettcar-Indie- und Gaslight Anthemn/Springsteen-Stadion-Rock. Es ist ihr viertes Album und nachdem sie bislang vor allem in UK-Gefilden unterwegs waren, wagen sie nun den Schritt zu uns. Auf ihrer Herbsttournee im Vorprogramm von Nothing But Thieves dürften sie sich einige Freunde gemacht haben. Und Potential ist reichlich vorhanden! Fast möchte man sich bremsen in seiner Euphorie über dieses ach so wunderschön gelungene Album, denn so gut Murray MacLeod als Sänger ist, so sehr quillt aus seinem Vortrag ein an Überheblichkeit grenzendes Selbstbewusstsein und eine Exaltiertheit, die an die Herren Hutchence, Morrison oder Jared Leto (30STM) erinnert. Mit dem Unterschied, dass die sich das über Jahre hinweg und viele Alben hinweg erarbeitet und verdient haben. Abgesehen davon sind zwei der drei genannten schon früh gestorben - und wir wollen doch noch länger etwas von den Xcerts haben!
Für KW 2: Kayak - Seventeen (InsideOut/Sony)
 Mit
einer Karriere von 45 Jahren sind sie eine der dienstältesten
Progressivrockbands – und eine der erfolgreichsten
holländischen Bands dazu. Mit einem runderneuertem Line-Up, in dem
Gründungsmitglied, Keyboarder Ton Scherpenzel von u.a. Kristoffer
Gildenlöw begleitet wird, hauen sie hier ein Album raus, bei dem
es schwer ist, zu sagen ob es absolut zeitgemäß oder einfach
nur zeitlos ist. Mit Drummer Colin Leiijenaar ist neben Gildenlöw
ein weiterer Musiker dabei, der in der Neal Morse-Band gespielt hat
– und offensichtlich in Sachen Songwriting hat abgucken
können. Dem Quintett ist es gelungen, gelungene Songideen in
klassische Progressivrock-Arrangements zu verpacken und mit einer
druckvollen Produktion zu versehen. Drei der zwölf Songs sind
zwischen knapp 9 und knapp 12 Minuten, daneben gibt es die Palette von
schnelleren und ruhigeren Songs, sehr gelungen und sehr schön!
Klare musikalische Referenz ist Camel, deren Keyboarder Scherpenzel ja
auch wiederholt war, und mit denen er zwischen 1984 und 1999 drei
Studioalben eingespielt hat. Und während man noch versucht,
daneben – und v.a. für die insgesamt rockigere Ausrichtung
von Kayak, eine weitere passenden Referenz zu finden, verrät das
Album-Info, dass ausgerechnet Andy Latimer auch Gast auf diesem Album
ist. Dann können wir uns das auch sparen – und freuen uns
über die Parallelen, die offensichtlich auch gar nicht vertuscht
werden sollen.
Mit
einer Karriere von 45 Jahren sind sie eine der dienstältesten
Progressivrockbands – und eine der erfolgreichsten
holländischen Bands dazu. Mit einem runderneuertem Line-Up, in dem
Gründungsmitglied, Keyboarder Ton Scherpenzel von u.a. Kristoffer
Gildenlöw begleitet wird, hauen sie hier ein Album raus, bei dem
es schwer ist, zu sagen ob es absolut zeitgemäß oder einfach
nur zeitlos ist. Mit Drummer Colin Leiijenaar ist neben Gildenlöw
ein weiterer Musiker dabei, der in der Neal Morse-Band gespielt hat
– und offensichtlich in Sachen Songwriting hat abgucken
können. Dem Quintett ist es gelungen, gelungene Songideen in
klassische Progressivrock-Arrangements zu verpacken und mit einer
druckvollen Produktion zu versehen. Drei der zwölf Songs sind
zwischen knapp 9 und knapp 12 Minuten, daneben gibt es die Palette von
schnelleren und ruhigeren Songs, sehr gelungen und sehr schön!
Klare musikalische Referenz ist Camel, deren Keyboarder Scherpenzel ja
auch wiederholt war, und mit denen er zwischen 1984 und 1999 drei
Studioalben eingespielt hat. Und während man noch versucht,
daneben – und v.a. für die insgesamt rockigere Ausrichtung
von Kayak, eine weitere passenden Referenz zu finden, verrät das
Album-Info, dass ausgerechnet Andy Latimer auch Gast auf diesem Album
ist. Dann können wir uns das auch sparen – und freuen uns
über die Parallelen, die offensichtlich auch gar nicht vertuscht
werden sollen.
Für KW 1: Blind Ego - Liquid Live (GAOM/Soulfood)
Danke lieber Kalle für dieses Album! Danke dafür, dass ich
es als Anlass nehmen kann, dein letztes Studioalbum noch einmal zu
erwähnen, das ich seinerzeit zwar genossen, aber keinesfalls
adäquat gewürdigt hatte. Ein Album, das es weit mehr war, als
ein weiteres Soloalbum des RPWL-Gitarristen, der mit seinen ersten
beiden Soloausflügen bereits gezeigt hatte, dass seine Interessen
auch abseits des Pink Floyd und New Artrock Universums liegen. Mit
Songs zwischen Melodic- und Hardrock, hier und da mit ein paar
progressiven Einsätzen erweitert, die zu gefallen wussten, aber
bis auf einige Highlights noch harmlos waren gegen das, was
„Liquid“ aufs Tapet brachte. Diese neun Songs zwischen
knapp 5 und gut 8 Minuten Länge waren nämlich eine
begeisternde Sammlung von Song-Highlights, die erst nach mehrmaligem
Hören ihre wahren Qualitäten offenbarte. Tolle Songs,
grandiose Musiker und ein Stapel Sänger, die zum
Abwechslungsreichtum beitrugen.
Mit Amon Ra-Sänger Scott Balaban hatte sich Kalle Wallner den Mann
herausgepickt, der alle Facetten dieses Albums und das der
Vorgänger optimal abdecken konnte – und der auch für
wiederholte Tourneen zur Verfügung stand. Die vorliegende
Veröffentlichung ist der Beweis für ein eingespieltes
Top-Team, die Lust macht auf mehr: Nach den Erfolgen im letzten Jahr
setzen die Jungs ihre Tournee nämlich noch fort! Am Dienstag, 30.
Januar sind sie (erneut) im Meisenfrei!