Jede Woche gibt es hier eine neue CD, die ich Euch gerne vorstelle! Mit Direktlink zum Anbieter meines Vertrauens.
Das war 2012: Die CDs der Woche in chronologischer Reihenfolge rückwärts:
Für KW 52: Purple Schulz – So und nicht anders (Rakete Medien / RTD)
 Er
kam 2012 zurück mit einem neuen Album - und hat auch 2012
immer noch eine Menge zu sagen. Mit seiner einzigartigen Mischung aus
Pop, Poesie, Chanson und Balladen präsentiert er sich als um-, wie
weitsichtiger und erwachsener Songwriter, der einem so manch
überraschend intimen Einblick verschaffen kann. Da hört man
eben noch das alte "Verliebte Jungs" Timbre heraus und freut sich im
nächsten Moment über ernstzunehmende Musikalität mit
Groove und Pepp. Da kommen Texte, die beweisen, dass er noch das alte
Zwinkern in den Augen hat, gefolgt von Songs, die einen innehalten
lassen und verstehen, was ihn getrieben hat, sein erstes Album nach 15
Jahren aufzunehmen. Beeindruckend!
Er
kam 2012 zurück mit einem neuen Album - und hat auch 2012
immer noch eine Menge zu sagen. Mit seiner einzigartigen Mischung aus
Pop, Poesie, Chanson und Balladen präsentiert er sich als um-, wie
weitsichtiger und erwachsener Songwriter, der einem so manch
überraschend intimen Einblick verschaffen kann. Da hört man
eben noch das alte "Verliebte Jungs" Timbre heraus und freut sich im
nächsten Moment über ernstzunehmende Musikalität mit
Groove und Pepp. Da kommen Texte, die beweisen, dass er noch das alte
Zwinkern in den Augen hat, gefolgt von Songs, die einen innehalten
lassen und verstehen, was ihn getrieben hat, sein erstes Album nach 15
Jahren aufzunehmen. Beeindruckend!
Für KW 51: Retrospective - Lost in Perception (Progressive Promotion)
 Retrospective
kommen aus Polen und untermauern die Stellung dieses Landes, wenn es um
Progressiv/Artrock geht. Wie Riverside, Quidam, Collage oder deren
Nachfolger agieren sie auf einem sehr professionellen Niveau. Und auch
wenn sie etwas weniger innovativ sind, erschaffen sie ein Album, das
höchstens an ihre Vorbilder erinnert, nicht aber deren Stil
kopiert. Zu diesen Vorbildern gehören Pink Floyd und die
erwähnten Riverside, genauso kann man auch Marillion oder
Porcupine Tree ins Feld führen. Wobei Riverside nicht nur aufgrund
der Nationalität stärkste Parallele bleibt, denn auch
Retrospective mischen ihre melodischen, oft auch leicht düsteren
Songs gerne hier und da mit kräftigen Heavy-Gitarren.
Die Stimme von Jakub Roszak wird wiederholt ergänzt durch die
Duett-Partnerin Beata Lagoda (Keyboards) und erinnert mich an eine
entspannte Version von Geoff Tate (Queensryche) und ist sehr gut -
allerdings nicht ganz akzentfrei...
Retrospective
kommen aus Polen und untermauern die Stellung dieses Landes, wenn es um
Progressiv/Artrock geht. Wie Riverside, Quidam, Collage oder deren
Nachfolger agieren sie auf einem sehr professionellen Niveau. Und auch
wenn sie etwas weniger innovativ sind, erschaffen sie ein Album, das
höchstens an ihre Vorbilder erinnert, nicht aber deren Stil
kopiert. Zu diesen Vorbildern gehören Pink Floyd und die
erwähnten Riverside, genauso kann man auch Marillion oder
Porcupine Tree ins Feld führen. Wobei Riverside nicht nur aufgrund
der Nationalität stärkste Parallele bleibt, denn auch
Retrospective mischen ihre melodischen, oft auch leicht düsteren
Songs gerne hier und da mit kräftigen Heavy-Gitarren.
Die Stimme von Jakub Roszak wird wiederholt ergänzt durch die
Duett-Partnerin Beata Lagoda (Keyboards) und erinnert mich an eine
entspannte Version von Geoff Tate (Queensryche) und ist sehr gut -
allerdings nicht ganz akzentfrei...
Für KW 50: Coldplay – Live 2012 (EMI)
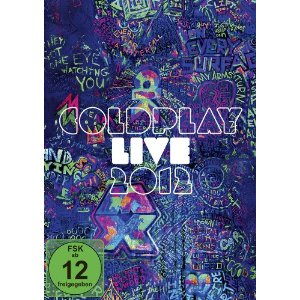 Wer
schon vorher Armbänder verteilt und dann mit einem Feuerwerk
startet, muss schon ganz schön was bieten, um die Spannung zu
halten… Coldplay schaffen es! Ihre Konzerte waren die
Mega-Events des Jahres, dieses CD/DVD-Doppelpack ist der eindrucksvolle
Beweis dafür. Als Zusammenschnitt verschiedener Konzerte gibt es
hier 100 Minuten Highlights. Die CD/DVD-Version ist insofern spannend,
als man dieses Spektakel schon einmal gesehen haben sollte, wenn man
nicht live im Stadion dabei war - mit u.a. Konfettiregen, parallel
geschalteten Leuchtarmbändern an 60.000 Zuschauer-Armen und
Rhiannas Gastauftritt. Leider wird alle 2-3 Songs unterbrochen mit
Interviewschnipseln, die zwar informativ und gut sind, aber den
Musikgenuss stark schmälern. Dafür gibt es die 15-Track CD
Version, die diese Unterbrechungen nicht hat, für den
"Normalbetrieb".
Wer
schon vorher Armbänder verteilt und dann mit einem Feuerwerk
startet, muss schon ganz schön was bieten, um die Spannung zu
halten… Coldplay schaffen es! Ihre Konzerte waren die
Mega-Events des Jahres, dieses CD/DVD-Doppelpack ist der eindrucksvolle
Beweis dafür. Als Zusammenschnitt verschiedener Konzerte gibt es
hier 100 Minuten Highlights. Die CD/DVD-Version ist insofern spannend,
als man dieses Spektakel schon einmal gesehen haben sollte, wenn man
nicht live im Stadion dabei war - mit u.a. Konfettiregen, parallel
geschalteten Leuchtarmbändern an 60.000 Zuschauer-Armen und
Rhiannas Gastauftritt. Leider wird alle 2-3 Songs unterbrochen mit
Interviewschnipseln, die zwar informativ und gut sind, aber den
Musikgenuss stark schmälern. Dafür gibt es die 15-Track CD
Version, die diese Unterbrechungen nicht hat, für den
"Normalbetrieb".
Für KW 49: Die Happy – 1000th Live Show (F.A.M.E.)
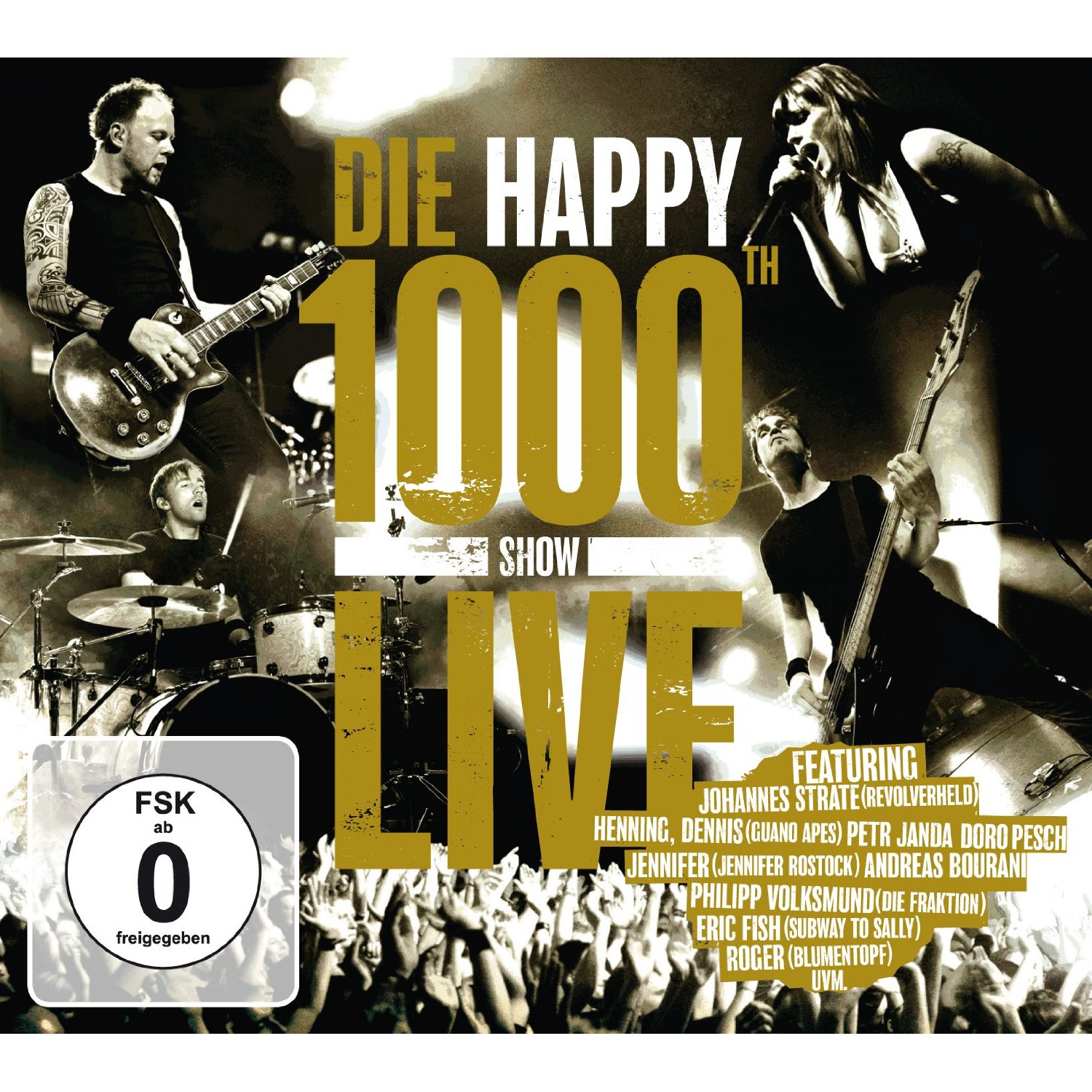 Das
musste CD (& DVD) werden: Zum Jubiläumskonzert luden sie sich
einen ganzen Stapel Gäste ein und zelebrierten (4 Stunden lang!)
einen spannenden Streifzug durch ihre Bandgeschichte. Das wird
naturgemäß auf der DVD Version erst richtig
vollständig, aber auch die CD macht schon immensen Spaß,
weil es die Highlights der Duette vereint. Wenn Martha sich
zunächst alleine in "Whatever" verliert und dann von Johannes
Strates Einsatz wieder aufgefangen wird ("Halt Dich an mir fest"), wenn
Andreas Bourani (plötzlich englischsprachig) "I Am" veredelt, wenn
Jennifer (Rostock) oder henning Rümenapp ihre volle Energie in die
Die Happy Hits legen, Doro Pesch einen sogar eigens übersetzt hat
und damit erweitert, dann sind das ohnehin schon rar gewordene Songs in
einmaligen Versionen. Wenn dann schließlich sogar Martha mit
ihrem Papa einen seiner Hits intoniert gibt es nicht nur in Ulm kein
Halten mehr. Sehr groß!
Das
musste CD (& DVD) werden: Zum Jubiläumskonzert luden sie sich
einen ganzen Stapel Gäste ein und zelebrierten (4 Stunden lang!)
einen spannenden Streifzug durch ihre Bandgeschichte. Das wird
naturgemäß auf der DVD Version erst richtig
vollständig, aber auch die CD macht schon immensen Spaß,
weil es die Highlights der Duette vereint. Wenn Martha sich
zunächst alleine in "Whatever" verliert und dann von Johannes
Strates Einsatz wieder aufgefangen wird ("Halt Dich an mir fest"), wenn
Andreas Bourani (plötzlich englischsprachig) "I Am" veredelt, wenn
Jennifer (Rostock) oder henning Rümenapp ihre volle Energie in die
Die Happy Hits legen, Doro Pesch einen sogar eigens übersetzt hat
und damit erweitert, dann sind das ohnehin schon rar gewordene Songs in
einmaligen Versionen. Wenn dann schließlich sogar Martha mit
ihrem Papa einen seiner Hits intoniert gibt es nicht nur in Ulm kein
Halten mehr. Sehr groß!
Für KW 48: Porcupine Tree - Octane Twisted (2CD Kscope/Edel)
 Dem
grandiosen 2009er Album „The Incident“ folgte eine
begeisternde Tournee, seitdem warten die Fans auf Neues. So man sich
denn noch Hoffnungen auf etwqas Neues machen kann... im Internet
zwitschern ja auch anderslautene Gerüchte!? Ohnehin gab es jede
Menge Soloaktivitäten aller Mitglieder – Steve
Wilsons zweites Soloalbum plus Zusammenarbeit mir Mikael Ackerfeldt,
Tour mit No-Man plus Solotournee, und auch seine Kollegen haben Alben
veröffentlicht – Richard Barbieri zusammen mit Steve
Hogarth, Gavin Harrison 05Ric, Colin Edwin sowohl mit Soloalbum,
als auch an seinem Metal Project Taste Of Blood. Mit "Octane Twisted"
erinnert Wilson jetzt noch einmal an die grandiose letzte Tournee - und
lässt die Optimisten weiter auf eine Fortsetzung hoffen. "Octane
Twisted" wurde aufgenommen in Chicago und lässt die Magie ihrer
letzten Tournee auferstehen. Das gelingt auf CD 1 nur zum Teil, denn
hier gibt es erwartungsgemäß die Live-Umsetzung des
"Incident"-Albums, CD2 schöpft dann allerdings aus dem Vollen! Mit
„Hatesong“, „Russia on Ice / The Pills I`m
taking“, “Stars die“, der Langversion von “Even
less” und “Arriving somewhere” gibt es hier absolute
Live-Highlights aus dem Backkatalog vereint. Eine richtiger Ersatz
für ein neues Album ist das nicht, aber es ist schön, dass
sie auf diese Tournee noch einmal zurückkommen.
Dem
grandiosen 2009er Album „The Incident“ folgte eine
begeisternde Tournee, seitdem warten die Fans auf Neues. So man sich
denn noch Hoffnungen auf etwqas Neues machen kann... im Internet
zwitschern ja auch anderslautene Gerüchte!? Ohnehin gab es jede
Menge Soloaktivitäten aller Mitglieder – Steve
Wilsons zweites Soloalbum plus Zusammenarbeit mir Mikael Ackerfeldt,
Tour mit No-Man plus Solotournee, und auch seine Kollegen haben Alben
veröffentlicht – Richard Barbieri zusammen mit Steve
Hogarth, Gavin Harrison 05Ric, Colin Edwin sowohl mit Soloalbum,
als auch an seinem Metal Project Taste Of Blood. Mit "Octane Twisted"
erinnert Wilson jetzt noch einmal an die grandiose letzte Tournee - und
lässt die Optimisten weiter auf eine Fortsetzung hoffen. "Octane
Twisted" wurde aufgenommen in Chicago und lässt die Magie ihrer
letzten Tournee auferstehen. Das gelingt auf CD 1 nur zum Teil, denn
hier gibt es erwartungsgemäß die Live-Umsetzung des
"Incident"-Albums, CD2 schöpft dann allerdings aus dem Vollen! Mit
„Hatesong“, „Russia on Ice / The Pills I`m
taking“, “Stars die“, der Langversion von “Even
less” und “Arriving somewhere” gibt es hier absolute
Live-Highlights aus dem Backkatalog vereint. Eine richtiger Ersatz
für ein neues Album ist das nicht, aber es ist schön, dass
sie auf diese Tournee noch einmal zurückkommen.
Für KW 47: Loosegoats - Ideas For To Travel Down Death's Merry Road (Startracks / Indigo)
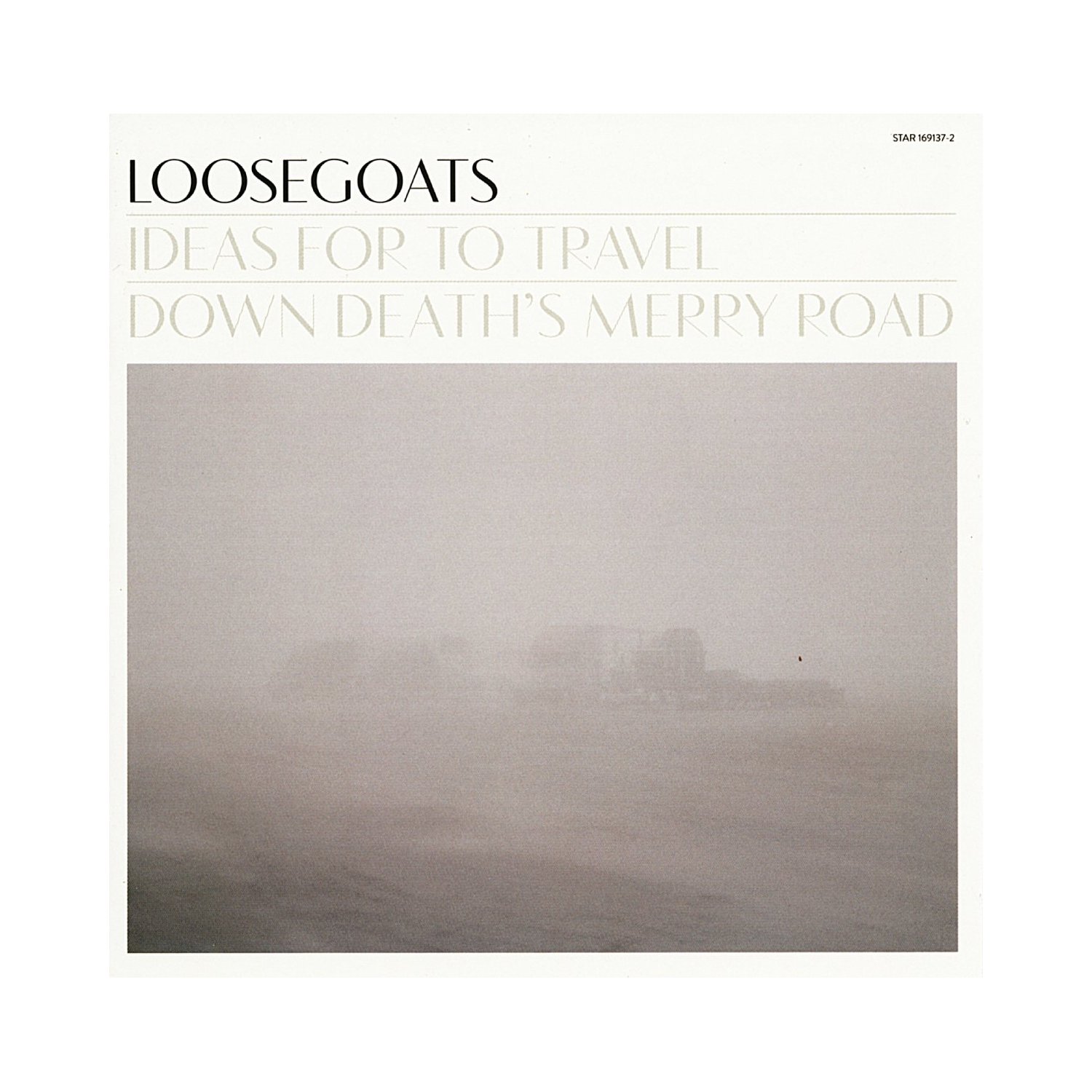 Dat
kannst' haben: Wenn das Album schon so einen langen Namen hat, brauch
ich ja nicht mehr viel zu schreiben. Passt mir ganz gut, hab eh gerade
so viel um die Ohren. Ach so, das Album: Zurück in die Zukunft?
Die Loosegoats war Christian Kjellvanders Band vor seiner Solokarriere,
noch etwas Rock-orientierter, etwas mehr Americana. 3 ½ Alben
gab’s zwischen 1997 und 2001, dann startete CK sein Soloding, nun
sind sie wieder da mit Album #4. Und das glänzt mit tollen Songs
zwischen Singer/Songwriter-Pop und Rock – viel mehr muss man gar
nicht dazu sagen!
Dat
kannst' haben: Wenn das Album schon so einen langen Namen hat, brauch
ich ja nicht mehr viel zu schreiben. Passt mir ganz gut, hab eh gerade
so viel um die Ohren. Ach so, das Album: Zurück in die Zukunft?
Die Loosegoats war Christian Kjellvanders Band vor seiner Solokarriere,
noch etwas Rock-orientierter, etwas mehr Americana. 3 ½ Alben
gab’s zwischen 1997 und 2001, dann startete CK sein Soloding, nun
sind sie wieder da mit Album #4. Und das glänzt mit tollen Songs
zwischen Singer/Songwriter-Pop und Rock – viel mehr muss man gar
nicht dazu sagen!
Für KW 46: World
Fire Brigade - Spreading
My Wings (Frostbyte Soulfood)
 Sie hatten sich eigentlich nur zusammengefunden, um mit
ihrer Songwriterkunst noch ein paar Dollar nebenbei zu verdienen: Brett
Scallions (Frontmann der Multi-Platin Band FUEL und Sänger eines Projekts von
Ray Manzarek und Robby Krieger von The Doors), Sean Danielsen (Sänger und
Gitarrist von Smile Empty Soul) und Eddie Wohl (Produzent/Mixer von Anthrax,
Ill Nino, Smile Empty Soul, Dry Kill Logic, 36 Crazy Fists etc) wollten Songs
schreiben und sie lizensieren oder anderen Künstlern anzubieten. Und dann
konnten sie wohl doch nicht loslassen. Warum auch? Aus den Instrumenten und der
Stimme dieses Quartetts ists wunderbar gelungen. Oder wie Scallions sagt:
"Diese Platte steckt voller Emotionen, Songs die zwischen Dur und Mol hin
und her gleiten. Ich mag, dass das Album heavy ist und Mitsingmelodien hat.“
Ich sage: Fett, fett, fett! Creed und Alter Bridge lassen grüßen mit einem noch
melodischerem Sänger – eine sehr gute Mischung! Gute Songs, gute Instrumentierung,
noch ein paar prominente Gäste – another fine Alt Rock band!
Sie hatten sich eigentlich nur zusammengefunden, um mit
ihrer Songwriterkunst noch ein paar Dollar nebenbei zu verdienen: Brett
Scallions (Frontmann der Multi-Platin Band FUEL und Sänger eines Projekts von
Ray Manzarek und Robby Krieger von The Doors), Sean Danielsen (Sänger und
Gitarrist von Smile Empty Soul) und Eddie Wohl (Produzent/Mixer von Anthrax,
Ill Nino, Smile Empty Soul, Dry Kill Logic, 36 Crazy Fists etc) wollten Songs
schreiben und sie lizensieren oder anderen Künstlern anzubieten. Und dann
konnten sie wohl doch nicht loslassen. Warum auch? Aus den Instrumenten und der
Stimme dieses Quartetts ists wunderbar gelungen. Oder wie Scallions sagt:
"Diese Platte steckt voller Emotionen, Songs die zwischen Dur und Mol hin
und her gleiten. Ich mag, dass das Album heavy ist und Mitsingmelodien hat.“
Ich sage: Fett, fett, fett! Creed und Alter Bridge lassen grüßen mit einem noch
melodischerem Sänger – eine sehr gute Mischung! Gute Songs, gute Instrumentierung,
noch ein paar prominente Gäste – another fine Alt Rock band!
Für KW 45: Rick Springfield - Songs for the End of the World (Frontiers Records)
 Ein
Star in den 80ern (als Musiker und Schauspieler), war es doch sehr
ruhig geworden um Rick Springfield in den letzten 15 Jahren.
„Hard to Hold“ (´84) und „Rock of Life“
(´88) waren die Alben, die ihn auch in Europa etablierten, mit
dem Rückgang des Interesses an US-Melodic Rock in den 90ern zog er
sich auf den amerikanischen Markt zurück – allerdings nicht
ohne weiterhin aktiv zu bleiben. Jetzt bringt das europäische
No.1-Rock-Import Label Frontiers Records (Journey, Toto, Asia, Yes
uva.) auch seine Alben bei uns auf den Markt. Was uns auf dieser
Seite des großen Teichs bei seinen Aktivitäten seit 1990
größtenteils verborgen geblieben ist, ist die Tatsache, dass
er mit seinen Alben jederzeit beweisen konnte, dass er auf der
Höhe der Zeit ist. So war der „Pop/Rock“ früherer
Alben schon auf seinen Veröffentlichungen von
„Shock/Denial/Anger/Acceptance (2004)“ bis „Venus in
Overdrive“ (2008) angereichert mit crunchigen Gitarren und
Alt.Rock-Arrangements. Auch sein neues Album geht in diese Richtung und
hat nebenbei mit „You and me“ mindestens einen veritablen
Hitkandidaten auf der Liste. Auch wenn Cover und Titel einen
künstlerischen Rückschritt in die Steinzeit befürchten
lässt, der Inhalt macht Spaß!
Ein
Star in den 80ern (als Musiker und Schauspieler), war es doch sehr
ruhig geworden um Rick Springfield in den letzten 15 Jahren.
„Hard to Hold“ (´84) und „Rock of Life“
(´88) waren die Alben, die ihn auch in Europa etablierten, mit
dem Rückgang des Interesses an US-Melodic Rock in den 90ern zog er
sich auf den amerikanischen Markt zurück – allerdings nicht
ohne weiterhin aktiv zu bleiben. Jetzt bringt das europäische
No.1-Rock-Import Label Frontiers Records (Journey, Toto, Asia, Yes
uva.) auch seine Alben bei uns auf den Markt. Was uns auf dieser
Seite des großen Teichs bei seinen Aktivitäten seit 1990
größtenteils verborgen geblieben ist, ist die Tatsache, dass
er mit seinen Alben jederzeit beweisen konnte, dass er auf der
Höhe der Zeit ist. So war der „Pop/Rock“ früherer
Alben schon auf seinen Veröffentlichungen von
„Shock/Denial/Anger/Acceptance (2004)“ bis „Venus in
Overdrive“ (2008) angereichert mit crunchigen Gitarren und
Alt.Rock-Arrangements. Auch sein neues Album geht in diese Richtung und
hat nebenbei mit „You and me“ mindestens einen veritablen
Hitkandidaten auf der Liste. Auch wenn Cover und Titel einen
künstlerischen Rückschritt in die Steinzeit befürchten
lässt, der Inhalt macht Spaß!
Für KW 44: Godspeed You! Black Emperor - Allelujah! Don’t Bend! Ascend! (Southern)
 Mit
ihren monumentalen Soundwällen, die auch gerne langstreckenweise
subtil im Leisen verharren, stehen sie zwischen Sigur Ros und Mogwai.
Ihr neues Album besteht aus gerade mal 4 Songs, je zur Hälfte 6
und 20 Minuten lang – mehr braucht es nicht, um zu
verzaubern! Rauer als bspw. Sigur Ros, eigenwilliger und
experimenteller auch, aber selten wirklich laut oder gar hart wuie
viele ihrer (instrumentalen) Post-Rock-Kollegen. Monumental.
Majestätisch.
Mit
ihren monumentalen Soundwällen, die auch gerne langstreckenweise
subtil im Leisen verharren, stehen sie zwischen Sigur Ros und Mogwai.
Ihr neues Album besteht aus gerade mal 4 Songs, je zur Hälfte 6
und 20 Minuten lang – mehr braucht es nicht, um zu
verzaubern! Rauer als bspw. Sigur Ros, eigenwilliger und
experimenteller auch, aber selten wirklich laut oder gar hart wuie
viele ihrer (instrumentalen) Post-Rock-Kollegen. Monumental.
Majestätisch.
Für KW 43: Andre Matos - The Turn of the Lights (e-a-r-Music/edel)
 Der
ex-Angra und u.a. Avantasia-Sänger mit seinem 3. Soloalbum.
Nachdem schon seine Stimme irgendwo zwischen Geoff Tate und Klaus
Dierks angesiedelt ist (wenn auch besser als beide!), ist auch seine
Musik im Prinzip zwischen diesen beiden Polen zu finden: Zwischen
Queensryche und Mob Rules, zwischen eingängigen Melodien und
Metal-Power. Das neue Album beginnt zunächst relativ Hard Rock-ig,
präsentiert dann ein paar herrliche (Puristen würden Balladen
sagen, ich nenn das mal) Pop-affine Songs und im weiteren Verlauf
vermengt sich das Ganze unter vereinzelter Zuhilfenahme von
Double-Bassdrum-Power zu einer sehr abwechslungsreichen Mischung. Auch
Prog-Elemente kann der geneigte Fan hier ausmachen, es bleibt also
durchweg interessant und spannend.
Der
ex-Angra und u.a. Avantasia-Sänger mit seinem 3. Soloalbum.
Nachdem schon seine Stimme irgendwo zwischen Geoff Tate und Klaus
Dierks angesiedelt ist (wenn auch besser als beide!), ist auch seine
Musik im Prinzip zwischen diesen beiden Polen zu finden: Zwischen
Queensryche und Mob Rules, zwischen eingängigen Melodien und
Metal-Power. Das neue Album beginnt zunächst relativ Hard Rock-ig,
präsentiert dann ein paar herrliche (Puristen würden Balladen
sagen, ich nenn das mal) Pop-affine Songs und im weiteren Verlauf
vermengt sich das Ganze unter vereinzelter Zuhilfenahme von
Double-Bassdrum-Power zu einer sehr abwechslungsreichen Mischung. Auch
Prog-Elemente kann der geneigte Fan hier ausmachen, es bleibt also
durchweg interessant und spannend.
Für KW 42: State Radio – Rabbit Inn Rebellion (Nettwerk/Soulfood)
 Über
den Umweg ihres Dispatch-Reunion Albums („Circles around the
Sun“ im September) wieder zurück zu alten Stärken?
Vielleicht konnten sie ihren Hang zum Folk-und-was-auch-immer dort
ausleben und ablegen, mit State Radio sind sie 2012 fast
ausschließlich in Sachen Rock unterwegs! Und zwar in grandios
epischer Weise – irgendwo zwischen Stoner- und Alternative Rock,
zwischen The Verve, Led Zeppelin und Wolfmother. Nicht, dass sie
diese Qualitäten nicht schon früher angedeutet hätten.
Ihr grandioses Debüt "Us Against the Crown" (2005, Album #1 nach
der Auflösung von Dispatch!) war wild, laut und auch ziemlich
verrückt, auf dem sie machten, was sie wollten. Mit einer
unvergleichlichen Mischung aus Rock, Reggae und Punk, irgendwo zwischen
Police, Lenny Kravitz und den Counting Crows. Aber die Konzentration
auf Ersteres liegt mir eigentlich – so! – noch viel mehr.
Starke Songs, toller Gesang, fette Produktion.
Über
den Umweg ihres Dispatch-Reunion Albums („Circles around the
Sun“ im September) wieder zurück zu alten Stärken?
Vielleicht konnten sie ihren Hang zum Folk-und-was-auch-immer dort
ausleben und ablegen, mit State Radio sind sie 2012 fast
ausschließlich in Sachen Rock unterwegs! Und zwar in grandios
epischer Weise – irgendwo zwischen Stoner- und Alternative Rock,
zwischen The Verve, Led Zeppelin und Wolfmother. Nicht, dass sie
diese Qualitäten nicht schon früher angedeutet hätten.
Ihr grandioses Debüt "Us Against the Crown" (2005, Album #1 nach
der Auflösung von Dispatch!) war wild, laut und auch ziemlich
verrückt, auf dem sie machten, was sie wollten. Mit einer
unvergleichlichen Mischung aus Rock, Reggae und Punk, irgendwo zwischen
Police, Lenny Kravitz und den Counting Crows. Aber die Konzentration
auf Ersteres liegt mir eigentlich – so! – noch viel mehr.
Starke Songs, toller Gesang, fette Produktion.
KW 41: And You Will Know Us By The Trail of Dead - Lost Songs (Supermusic / EMI)
 Da
sind sie wieder! Die Pioniere der Verbindung aus Progressive/New Art-
und Alternative-Rock. Noch immer nennen sie gerne Bands wie Fugazi,
Melvins und Sonic Youth neben Led Zeppelin, Rush, Genesis und Pink
Floyd als ihre Einflüsse, lassen nebenbei noch Public Enemy, Bach
und Vivaldi fallen, um die Verwirrung komplett zu machen, bzw. die
Bandbreite noch etwas zu erweitern... Letztere müssen, glaube ich
nicht in ihrer Musik gesucht werden. Und noch immer beginnen sie ihr
Album sehr mächtig mit dem 5-Minüter "Open Doors" und
schlagen damit den Bogen zu ihrer durchaus verspielteren,
"progressiveren" Vergangenheit. Die 5-Minutengrenze überqueren sie
indes kein weiteres Mal und auch die progressiven Elemente sind nicht
mehr so deutlich wie auf den letzten Werken, allen voran das grandiose
"Worlds Apart". Zwar erscheinen selbst manche 3-4 Minüter wie
Mini-Epen ("Opera Obscura"; "Catatonic") und klingen Rocker wie
"Pinhole Cameras" wie Rush mit neuem Shouter, aber insgesamt ist "Lost
Songs", aufgenommen übrigens in Hannover, eher ein straightes
Rockalbum. Indes eins mit guten Songs! Ausfälle gibt es kaum, und
mit „Awestruck“ könnte hier fast ein "Single-Hit
abfallen!
Da
sind sie wieder! Die Pioniere der Verbindung aus Progressive/New Art-
und Alternative-Rock. Noch immer nennen sie gerne Bands wie Fugazi,
Melvins und Sonic Youth neben Led Zeppelin, Rush, Genesis und Pink
Floyd als ihre Einflüsse, lassen nebenbei noch Public Enemy, Bach
und Vivaldi fallen, um die Verwirrung komplett zu machen, bzw. die
Bandbreite noch etwas zu erweitern... Letztere müssen, glaube ich
nicht in ihrer Musik gesucht werden. Und noch immer beginnen sie ihr
Album sehr mächtig mit dem 5-Minüter "Open Doors" und
schlagen damit den Bogen zu ihrer durchaus verspielteren,
"progressiveren" Vergangenheit. Die 5-Minutengrenze überqueren sie
indes kein weiteres Mal und auch die progressiven Elemente sind nicht
mehr so deutlich wie auf den letzten Werken, allen voran das grandiose
"Worlds Apart". Zwar erscheinen selbst manche 3-4 Minüter wie
Mini-Epen ("Opera Obscura"; "Catatonic") und klingen Rocker wie
"Pinhole Cameras" wie Rush mit neuem Shouter, aber insgesamt ist "Lost
Songs", aufgenommen übrigens in Hannover, eher ein straightes
Rockalbum. Indes eins mit guten Songs! Ausfälle gibt es kaum, und
mit „Awestruck“ könnte hier fast ein "Single-Hit
abfallen!
Für KW 40: Threshold - March of Progress (Nuclear Blast)
 Die
Turbolenzen im Besetzungskarussell erinnern fast an Yes – hier
allerdings lediglich auf den Mikroposten bezogen. Nun ist es also
wieder Damian Wilson, der 2007 bereits den ausgestiegenen (und danach
verstorbenen) Andrew MacDermott für die Tournee ersetzte und dann
auch gleich wieder fest mit einstieg. Also der Mann, mit dem alles
begann, der zwischendurch sein Glück (u.a. erfolglos bei Iron
Maiden,) in Musicals und anderswo versuchte, der aber diesen Job
einfach bestens ausfüllt. Ihrer musikalischen Ausrichtung haben
die Wechsel – abgesehen vielleicht vom Einstieg des Shouters
Glynn Morgan für ein Album – kaum geschadet. Im Gegenteil:
Die Band hat sich stetig weiterentwickelt, hat an der Finesse ihrer
Kompositionen gefeilt, hat verschiedene Dinge ausprobiert und hat sich
immer wieder zu neuen Großtaten aufgeschwungen. Die
grundsätzliche Mischung aus harten Metalgitarren und
atmosphärischen Keyboard- und Melodikpassagen bot immer genug
Platz für neue Wege, Songs und Sounds. An dieser Mischung hat sich
auch für „March of Progress“ nichts geändert. Der
Opener „Ashes“ ist schon gut, „Staring at the
Sun“ bringt es in Single-Länge auf den Punkt,
„Liberty, …“ ist das erste Highlight,
„Colophan“ in der Mitte ist schlicht grandios,
„Don’t look down“ und „Coda“ besitzen
auch alles, was einen Threshold-Song ausmachen muss… noch
Fragen? Man könnte konstatieren, dass sich hier nichts groß
Neues entwickelt hat, aber die Frage ist, inwieweit das überhaupt
nötig ist! Und nach einem Besetzungswechsel ist eh erstmal
Schonfrist… ;-). Saustark!
Die
Turbolenzen im Besetzungskarussell erinnern fast an Yes – hier
allerdings lediglich auf den Mikroposten bezogen. Nun ist es also
wieder Damian Wilson, der 2007 bereits den ausgestiegenen (und danach
verstorbenen) Andrew MacDermott für die Tournee ersetzte und dann
auch gleich wieder fest mit einstieg. Also der Mann, mit dem alles
begann, der zwischendurch sein Glück (u.a. erfolglos bei Iron
Maiden,) in Musicals und anderswo versuchte, der aber diesen Job
einfach bestens ausfüllt. Ihrer musikalischen Ausrichtung haben
die Wechsel – abgesehen vielleicht vom Einstieg des Shouters
Glynn Morgan für ein Album – kaum geschadet. Im Gegenteil:
Die Band hat sich stetig weiterentwickelt, hat an der Finesse ihrer
Kompositionen gefeilt, hat verschiedene Dinge ausprobiert und hat sich
immer wieder zu neuen Großtaten aufgeschwungen. Die
grundsätzliche Mischung aus harten Metalgitarren und
atmosphärischen Keyboard- und Melodikpassagen bot immer genug
Platz für neue Wege, Songs und Sounds. An dieser Mischung hat sich
auch für „March of Progress“ nichts geändert. Der
Opener „Ashes“ ist schon gut, „Staring at the
Sun“ bringt es in Single-Länge auf den Punkt,
„Liberty, …“ ist das erste Highlight,
„Colophan“ in der Mitte ist schlicht grandios,
„Don’t look down“ und „Coda“ besitzen
auch alles, was einen Threshold-Song ausmachen muss… noch
Fragen? Man könnte konstatieren, dass sich hier nichts groß
Neues entwickelt hat, aber die Frage ist, inwieweit das überhaupt
nötig ist! Und nach einem Besetzungswechsel ist eh erstmal
Schonfrist… ;-). Saustark!
Für KW 39: Muse – The 2nd Law (Warner)
 Man
hatte Einiges lesen können im Vorfeld, durfte Befürchtungen
hegen, dass man als früher Muse-Fan auch in Zukunft immer mehr
Probleme haben könnten mit dem Größenwahn der Briten,
der relativ doofe Olympia-Song „Survival“ trug auch nicht
gerade dazu bei, die Vorfreude zu steigern… – und dann
das! Fast möchte man sagen „back tot he roots“,
zurück zum (zugegeben großen) Indie-Rock, (zwar mit)
schwelgerischen Melodien, aber ohne übertriebenen Pathos und vor
allem mit einem Stapel richtig guter Songs! Und sogar Sänger Matt
Bellamy geht mal einen Schritt zurück und lässt (!) Bassist
Chris Wolstenholme nicht nur schreiben, sondern auch singen! Da kommen
plötzlich nicht nur ganz entspannte Songs heraus („Save
me“ auf einem Muse-Album?!), da vermittelt das ganze Album so
eine ausgeglichene Atmosphäre. Sensationell. Gut!! Da darf es
auch am Ende mal wieder (modern-)klassisch werden mit der
Abschluss-Titel-Sinfonie, denn auch das sind und waren immer Muse.
Allerdings ist dieses Song-Doppel verzichtbar. Macht ja nix, der Rest
des Albums hat genügend Stärken, um diese Schwächen
aufzufangen.
Man
hatte Einiges lesen können im Vorfeld, durfte Befürchtungen
hegen, dass man als früher Muse-Fan auch in Zukunft immer mehr
Probleme haben könnten mit dem Größenwahn der Briten,
der relativ doofe Olympia-Song „Survival“ trug auch nicht
gerade dazu bei, die Vorfreude zu steigern… – und dann
das! Fast möchte man sagen „back tot he roots“,
zurück zum (zugegeben großen) Indie-Rock, (zwar mit)
schwelgerischen Melodien, aber ohne übertriebenen Pathos und vor
allem mit einem Stapel richtig guter Songs! Und sogar Sänger Matt
Bellamy geht mal einen Schritt zurück und lässt (!) Bassist
Chris Wolstenholme nicht nur schreiben, sondern auch singen! Da kommen
plötzlich nicht nur ganz entspannte Songs heraus („Save
me“ auf einem Muse-Album?!), da vermittelt das ganze Album so
eine ausgeglichene Atmosphäre. Sensationell. Gut!! Da darf es
auch am Ende mal wieder (modern-)klassisch werden mit der
Abschluss-Titel-Sinfonie, denn auch das sind und waren immer Muse.
Allerdings ist dieses Song-Doppel verzichtbar. Macht ja nix, der Rest
des Albums hat genügend Stärken, um diese Schwächen
aufzufangen.
Für KW 38: Skunk Anansie - Black Traffic (e-a-r Music / Edel)
 Das
Schöne an dieser Band ist, dass man hier wenig verkehrt machen
kann. So unkompromisslos, wie man Sängerin Skin wie auch die Band
um sie herum kennengelernt hat, so sehr halten sie doch fest an den
Werten, für die sie stehen. Und das sind zunächst mal
großer Rock, gerne auch etwas schwerer oder schneller oder auch
härter (wie der, bzw. die Opener des neuen Albums beweisen). Da
rumpelt es kräftig und bläst die Gehörgänge frei.
Das sind Skunk Anansie! Umso entspannter klingen die Songs, die danach
die Richtung wechseln, die Melodien noch ein bisschen größer
schreiben und das Tempo drosseln. Auch das sind Skunk Anansie.
Wichtigstes Stilmittel ihres Sounds ist allerdings die Stimme Skins,
die Energie und Emotion, die sie den Songs mitgibt ist grandios. Und
ohne ihre Soloalben abwerten zu wollen, mit diesen Kollegen hier an
ihrer Seite passt das Ganze doch noch einen Tick besser! Richtig
groß sind dann die Momente, in denen sie ihren Rock in breite
Epen verpacken, wie in „I hope you get to meet your hero“
oder (!) „Drowning“ (!). Auch das sind Skunk Anansie
– und damit haben sie sich wahrscheinlich auch in der
Vergangenheit schon die meisten Freunde machen können. Das
möchten sie auch auf dem neuen Album nicht vergessen. Sie wissen
eben, wofür sie stehen. Und gute Songs schreiben können sie
eben auch. Da kann man nicht viel verkehrt machen.
Das
Schöne an dieser Band ist, dass man hier wenig verkehrt machen
kann. So unkompromisslos, wie man Sängerin Skin wie auch die Band
um sie herum kennengelernt hat, so sehr halten sie doch fest an den
Werten, für die sie stehen. Und das sind zunächst mal
großer Rock, gerne auch etwas schwerer oder schneller oder auch
härter (wie der, bzw. die Opener des neuen Albums beweisen). Da
rumpelt es kräftig und bläst die Gehörgänge frei.
Das sind Skunk Anansie! Umso entspannter klingen die Songs, die danach
die Richtung wechseln, die Melodien noch ein bisschen größer
schreiben und das Tempo drosseln. Auch das sind Skunk Anansie.
Wichtigstes Stilmittel ihres Sounds ist allerdings die Stimme Skins,
die Energie und Emotion, die sie den Songs mitgibt ist grandios. Und
ohne ihre Soloalben abwerten zu wollen, mit diesen Kollegen hier an
ihrer Seite passt das Ganze doch noch einen Tick besser! Richtig
groß sind dann die Momente, in denen sie ihren Rock in breite
Epen verpacken, wie in „I hope you get to meet your hero“
oder (!) „Drowning“ (!). Auch das sind Skunk Anansie
– und damit haben sie sich wahrscheinlich auch in der
Vergangenheit schon die meisten Freunde machen können. Das
möchten sie auch auf dem neuen Album nicht vergessen. Sie wissen
eben, wofür sie stehen. Und gute Songs schreiben können sie
eben auch. Da kann man nicht viel verkehrt machen.
Für KW 37: Neal Morse - Momentum (InsideOut / EMI)
 Das
nenne ich mal gesunden Optimismus: Weil er gesehen hatte, dass sein
Hausdrummer Mike Portnoy im Januar noch Platz im Kalender hatte, buchte
er ihn spontan – nebst liebgewonnenen Sideman Randy George (bs)
– allerdings ohne Songs für ein Album in greifbarer
Nähe zu haben. Mal sehen was kommt. Dass dabei ein so kreatives
Feuerwerk herausgekommen ist, dürfte sogar die alten Fans
überraschen, die längst gewohnt sind, vom Songwritermeister
aller Klassen nur das Beste erwarten zu können. Beginnend mit
einem furiosen Titelstück legt das Album in Track 2 sogar noch
einen drauf in einer neuen Fortsetzung des sprühenden
Spock`s-Klassikers „Thoughts“ (hier pt. 5). Mit an
Bord ist auch Saitenzauberer Paul Gilbert wieder, ein Team, das seit
„Lifeline“ genial nahe an den Meisterwerken der Supergroup
Transatlantic komponiert und instrumentiert. Auch
„Momentum“ ist eine vollendete Mischung aus Prog, fettem
Rock, Hooklines, Melodien und Vokalharmonien. Lediglich der finale
Longtrack „World without end“ scheint mit seinen knapp 34
Minuten etwas „over the top“ – aber das kann
verständlicherweise auch nach weniger als 20
Hördurchgängen nicht abschließend beurteilt werden!
Das
nenne ich mal gesunden Optimismus: Weil er gesehen hatte, dass sein
Hausdrummer Mike Portnoy im Januar noch Platz im Kalender hatte, buchte
er ihn spontan – nebst liebgewonnenen Sideman Randy George (bs)
– allerdings ohne Songs für ein Album in greifbarer
Nähe zu haben. Mal sehen was kommt. Dass dabei ein so kreatives
Feuerwerk herausgekommen ist, dürfte sogar die alten Fans
überraschen, die längst gewohnt sind, vom Songwritermeister
aller Klassen nur das Beste erwarten zu können. Beginnend mit
einem furiosen Titelstück legt das Album in Track 2 sogar noch
einen drauf in einer neuen Fortsetzung des sprühenden
Spock`s-Klassikers „Thoughts“ (hier pt. 5). Mit an
Bord ist auch Saitenzauberer Paul Gilbert wieder, ein Team, das seit
„Lifeline“ genial nahe an den Meisterwerken der Supergroup
Transatlantic komponiert und instrumentiert. Auch
„Momentum“ ist eine vollendete Mischung aus Prog, fettem
Rock, Hooklines, Melodien und Vokalharmonien. Lediglich der finale
Longtrack „World without end“ scheint mit seinen knapp 34
Minuten etwas „over the top“ – aber das kann
verständlicherweise auch nach weniger als 20
Hördurchgängen nicht abschließend beurteilt werden!
Für KW 36: The Pineapple Thief - All The Wars (Kscope/Edel)
 Bruce
Soord hat seine Wandlungsfähigkeit bereits mit den viel zu wenig
beachteten Vulgar Unicorn bewiesen, seinen Humor u.a. auch mit deren
Reinkarnation namens Persona Non Grata. Seit 1999 hat er indes
umgesattelt und veröffentlicht hauptsächlich mit seiner Band
Pineapple Thief – und das mit steigendem Erfolg! Dem grandiosen
2010er Album "Someone Here Is Missing", mit dem die Band auch über
alle Genregrenzen hinaus beste Kritiken erhielt, folgt mit dem neuen
Album ein Schritt zum Opulenten. Hier werden die bereits
„gewohnten“ Zutaten, die an Bands wie Radiohead, Pink Floyd
oder Muse erinnern mit Referenzen an Peter Gabriel (ein Ergebnis der
Aufnahmen in Peter Gabriel`s Real World Studios?) ergänzt.
Violinisten und Chor machen den Sound ihres 7. Albums noch fetter und
professioneller und reflektiert den gewachsenen Status der Band. Wie
Soord erklärt: "Bei der Produktion wurden keine Kosten gescheut,
aber im Herzen ist es immer noch eine Rock Platte. An einigen Stellen
sehr heavy, filigran und schön an anderen." Dem ist eigentlich
nicht viel hinzuzufügen!
Bruce
Soord hat seine Wandlungsfähigkeit bereits mit den viel zu wenig
beachteten Vulgar Unicorn bewiesen, seinen Humor u.a. auch mit deren
Reinkarnation namens Persona Non Grata. Seit 1999 hat er indes
umgesattelt und veröffentlicht hauptsächlich mit seiner Band
Pineapple Thief – und das mit steigendem Erfolg! Dem grandiosen
2010er Album "Someone Here Is Missing", mit dem die Band auch über
alle Genregrenzen hinaus beste Kritiken erhielt, folgt mit dem neuen
Album ein Schritt zum Opulenten. Hier werden die bereits
„gewohnten“ Zutaten, die an Bands wie Radiohead, Pink Floyd
oder Muse erinnern mit Referenzen an Peter Gabriel (ein Ergebnis der
Aufnahmen in Peter Gabriel`s Real World Studios?) ergänzt.
Violinisten und Chor machen den Sound ihres 7. Albums noch fetter und
professioneller und reflektiert den gewachsenen Status der Band. Wie
Soord erklärt: "Bei der Produktion wurden keine Kosten gescheut,
aber im Herzen ist es immer noch eine Rock Platte. An einigen Stellen
sehr heavy, filigran und schön an anderen." Dem ist eigentlich
nicht viel hinzuzufügen!
Für KW 35: Archive - With us until you`re dead (Dangervisit Records / V2)
 Der
Albumtitel deutet leichten Größenwahn an – aber in der
Tat haben sie so viele geniale Songs geschaffen, da wird es viele Fans
geben, die ihnen bis zu ihrem Ende treu bleiben (wollen). Aber die
Briten stellen ihre Fans auch gerne auf die Probe. Die Electronic
Fraktion ihrer frühen Tage z.B. mit den (Prog-)Rock-Elementen
ihrer „zweiten“ Phase (beginnend mit „You all look
the same to me“), die ihren Aufstieg manifestierte. Seit ein paar
Jahren liebäugeln sie verstärkt wieder mit der Pop-Seite. Auf
ihrem neuen Album zwar nicht mit den HipHop-Anteilen ihres letzten
Doppelschlags „Controlling Crowds“ (pt. 1 & 2), aber
hier mit Sound, Stimmungen und Elektronik. Das resultiert
überwiegend immer noch in magisch schönen Momenten, aber
nicht immer in guten, bzw. voll überzeugenden Songs. So bleibt man
zurück mit gemischten Gefühlen – denn wie eingangs
angedeutet: Diese Band ist zunächst einmal grandios. Nur nicht
ausschließlich perfekt.
Der
Albumtitel deutet leichten Größenwahn an – aber in der
Tat haben sie so viele geniale Songs geschaffen, da wird es viele Fans
geben, die ihnen bis zu ihrem Ende treu bleiben (wollen). Aber die
Briten stellen ihre Fans auch gerne auf die Probe. Die Electronic
Fraktion ihrer frühen Tage z.B. mit den (Prog-)Rock-Elementen
ihrer „zweiten“ Phase (beginnend mit „You all look
the same to me“), die ihren Aufstieg manifestierte. Seit ein paar
Jahren liebäugeln sie verstärkt wieder mit der Pop-Seite. Auf
ihrem neuen Album zwar nicht mit den HipHop-Anteilen ihres letzten
Doppelschlags „Controlling Crowds“ (pt. 1 & 2), aber
hier mit Sound, Stimmungen und Elektronik. Das resultiert
überwiegend immer noch in magisch schönen Momenten, aber
nicht immer in guten, bzw. voll überzeugenden Songs. So bleibt man
zurück mit gemischten Gefühlen – denn wie eingangs
angedeutet: Diese Band ist zunächst einmal grandios. Nur nicht
ausschließlich perfekt. Die August - Highlights gab es für die KW 30-34 - v.a. aus urlaubstechnischen Gründen - gesammelt und in alphabetischer Reihenfolge:
Alberta Cross – Songs of Patience (PIAS, VÖ 31.8.)
 Melodischer
Rock zwischen Vorwärtsdrive und Melancholie, zwischen Kings of
Leon und Snow Patrol: auf ihrem zweiten Album geben sich der Schwede
Petter Ericson Stakee (v, g) und der Londoner Terry Wolfers (b) mit
Wahlheimat Brooklyn fast etwas melodischer als auf ihrem Debüt,
halten sich aber ansonsten größtenteils an die Vorgaben des
Debüts. Was ok ist für ein 2. Album – vor allem, wenn
die Songs so unverschämt eingängig sind. Die Songs wechseln
zwischen großer Rock-Hymne („come on maker“,
„Ophelia on my mind“, „I believe in
everything“) und eingängiger Hookline
(„wasteland“), zwischendurch wird’s fast etwas arg
einfach („Money for the weekend“), so dass sowohl Rockfans
des Debüts als auch Radiostationen mit diesem Werk glücklich
werden sollten.
Melodischer
Rock zwischen Vorwärtsdrive und Melancholie, zwischen Kings of
Leon und Snow Patrol: auf ihrem zweiten Album geben sich der Schwede
Petter Ericson Stakee (v, g) und der Londoner Terry Wolfers (b) mit
Wahlheimat Brooklyn fast etwas melodischer als auf ihrem Debüt,
halten sich aber ansonsten größtenteils an die Vorgaben des
Debüts. Was ok ist für ein 2. Album – vor allem, wenn
die Songs so unverschämt eingängig sind. Die Songs wechseln
zwischen großer Rock-Hymne („come on maker“,
„Ophelia on my mind“, „I believe in
everything“) und eingängiger Hookline
(„wasteland“), zwischendurch wird’s fast etwas arg
einfach („Money for the weekend“), so dass sowohl Rockfans
des Debüts als auch Radiostationen mit diesem Werk glücklich
werden sollten.
Max Buskohl - Sidewalk Conversation (Vertigo/Universal, VÖ 31.8.)
 Die
gute Nachricht ist, dass Castingformate wie DSDS offensichtlich doch
nicht nur dazu da sind, One-Hit-Eintagsfliegen und Chartsfutter
hervorzubringen, sondern sich der eine oder andere Name auch
langfristig etablieren kann, bzw. in Erinnerung bleibt. Das ist umso
erstaunlicher, da öffentliche Multiplikatoren wie das Radio sich
den DSDS-Schützlingen komplett verschlossen hat. Max Buskohl hatte
damals zunächst mit spektakulären Rocksongs Furore gemacht,
später dann mit seinem überraschenden frühzeitigen
Ausstieg trotz aller Siegchancen. Zu spät allerdings, um seine
Credibility zu erhalten, wie er schmerzlich feststellen musste. 2007
versuchte er es dann erstmals, seine Popularität in Erfolg
umzumünzen, veröffentlichte mit seiner (schon vor DSDS-Zeiten
existenten) Band Empty Trash das Album „Confession“ und
tourte fleißig – aber offensichtlich ohne durchschlagendem
Erfolg: 2009 gaben sie ihre Trennung bekannt.
Die
gute Nachricht ist, dass Castingformate wie DSDS offensichtlich doch
nicht nur dazu da sind, One-Hit-Eintagsfliegen und Chartsfutter
hervorzubringen, sondern sich der eine oder andere Name auch
langfristig etablieren kann, bzw. in Erinnerung bleibt. Das ist umso
erstaunlicher, da öffentliche Multiplikatoren wie das Radio sich
den DSDS-Schützlingen komplett verschlossen hat. Max Buskohl hatte
damals zunächst mit spektakulären Rocksongs Furore gemacht,
später dann mit seinem überraschenden frühzeitigen
Ausstieg trotz aller Siegchancen. Zu spät allerdings, um seine
Credibility zu erhalten, wie er schmerzlich feststellen musste. 2007
versuchte er es dann erstmals, seine Popularität in Erfolg
umzumünzen, veröffentlichte mit seiner (schon vor DSDS-Zeiten
existenten) Band Empty Trash das Album „Confession“ und
tourte fleißig – aber offensichtlich ohne durchschlagendem
Erfolg: 2009 gaben sie ihre Trennung bekannt.Jetzt ist er wieder da, versucht es unter eigenem Namen, und mit einem Album, das nicht nur sehr viel abwechslungsreicher ist, als der Empty Trash Output, sondern eigentlich genau das bietet, was man ihm immer zugetraut hat, bzw, von ihm erwartet hat: „Sidewalk Conversation“ ist ein professionelles Album mit grandiosen Songs und einer opulenten Produktion. Großes Songwriting, spannende Rocksongs, charismatischer Gesang – ein tolles Album, das den Grundstein legen sollte für eine Karriere als ernstzunehmender Pop/Rock-Künstler – so man ihn denn lässt und wahrnimmt und ernst nimmt! Denn dann ist diesem Kerl noch einiges zuzutrauen!
Madsen – Wo es beginnt (Four Music / Columbia, VÖ 17.8.)
 „Die
Reise geht weiter, es hört nie auf, … ich stehe da wo meine
Füße sind, wo es beginnt“ - das Album startet fast
etwas philosophisch, aber Sänger Sebastian Madsen haut ja ganz
gerne so einen Text raus, der durchaus passt. Denn auch seine Stimme
kippt hier gerne auch wieder in alte Screamo-Nähe – also
dorthin wo alles begann. Auf dem letzten Album hatte er noch komplett
drauf verzichtet, nachdem er gemerkt hatte, dass es gerne auch darauf
reduziert wird. Hat ihn aber offensichtlich auch nicht befriedigt. Oder
war es das Album insgesamt, das überraschend gemäßigt
daherkam? Vielleicht beides. Entsprechend besucht das neue Album viele
Stationen, die die Wendländer in zehn Jahren besucht haben. Er
schreit und flucht, er singt und säuselt und bringt es auf den
Punkt: „Es wird schon alles wieder gut“. Sänger
Sebastian Madsen ist das Herz dieser Band, und das schlägt 2012
auch gerne mal wieder wild und laut, harmoniert im nächsten Moment
aber auch exzellent im Duettgesang. Damit bringt die Band alle ihre
Qualitäten zusammen und es passt wunderbar!
„Die
Reise geht weiter, es hört nie auf, … ich stehe da wo meine
Füße sind, wo es beginnt“ - das Album startet fast
etwas philosophisch, aber Sänger Sebastian Madsen haut ja ganz
gerne so einen Text raus, der durchaus passt. Denn auch seine Stimme
kippt hier gerne auch wieder in alte Screamo-Nähe – also
dorthin wo alles begann. Auf dem letzten Album hatte er noch komplett
drauf verzichtet, nachdem er gemerkt hatte, dass es gerne auch darauf
reduziert wird. Hat ihn aber offensichtlich auch nicht befriedigt. Oder
war es das Album insgesamt, das überraschend gemäßigt
daherkam? Vielleicht beides. Entsprechend besucht das neue Album viele
Stationen, die die Wendländer in zehn Jahren besucht haben. Er
schreit und flucht, er singt und säuselt und bringt es auf den
Punkt: „Es wird schon alles wieder gut“. Sänger
Sebastian Madsen ist das Herz dieser Band, und das schlägt 2012
auch gerne mal wieder wild und laut, harmoniert im nächsten Moment
aber auch exzellent im Duettgesang. Damit bringt die Band alle ihre
Qualitäten zusammen und es passt wunderbar!Alanis Morissette - Havoc and bright Lights (Columbia Seven One, 24.8)
 Was
erwarten wir von einem neuen Album einer Künstlerin wie Alanis
Morissette? Am besten keine großartigen Veränderungen,
sondern einfach nur große Songs, oder? Ein bisschen Rock, ein
bisschen Pop, ein paar schöne Balladen, insgesamt eine gute
Mischung und vor allem Songs, die den richtigen Ton, den richtigen
Groove, die richtige Stimmung finden. Wenn dazu noch
Authentizität, Emotionen und halbwegs gute Texte kommen, dann kann
eigentlich nicht viel schiefgehen – und in der Tat bekommt der
Hörer genau das auf dem neuen Werk der Kanadierin!
Was
erwarten wir von einem neuen Album einer Künstlerin wie Alanis
Morissette? Am besten keine großartigen Veränderungen,
sondern einfach nur große Songs, oder? Ein bisschen Rock, ein
bisschen Pop, ein paar schöne Balladen, insgesamt eine gute
Mischung und vor allem Songs, die den richtigen Ton, den richtigen
Groove, die richtige Stimmung finden. Wenn dazu noch
Authentizität, Emotionen und halbwegs gute Texte kommen, dann kann
eigentlich nicht viel schiefgehen – und in der Tat bekommt der
Hörer genau das auf dem neuen Werk der Kanadierin! Vier Jahre sind seit ihrem letzten – und sehr durchwachsenen, um nicht zu sagen eher schwachem – Album, ihrem „Trennungsalbum“ (Flavors of Entanglement) vergangen, vier Jahre in denen sie geheiratet und einen Sohn bekommen hat, sich ihr Lebensgleichgewicht also in vielerlei Hinsicht zum Positiven gewendet haben dürfte. Beste Voraussetzungen für ein Album, das genau die oben beschriebenen Merkmale erfüllt. „Havoc and bright Lights” ist jetzt kein Album, das zu Luftsprüngen und Salti motiviert, aber mit Songs wie u.a. „Guardian“, „Empathy“, „Receive“ oder „Edge of Evolution“ ein paar richtig famose Songs enthält, die dieses Album zu einem der besseren ihrer Karriere machen. Thank you!
The Unwinding Hours - Afterlives (Chemikal Underground / RTD, VÖ 24.8.)
 Mit
Aerogramme hatten sie sich einen Namen gemacht, nach Stimmproblemen und
damit verbundenen Veränderungen in Gesang und Musik war eine
Umbenennung eine radikale, aber nachvollziehbare Konsequenz. Bereits
auf ihrem ersten Album unter „Unwinding Hours“-Banner
hatten Iain Cook und Craig B bewiesen, dass sie an der
grundsätzlichen, spannungsgeladenen Mischung aus feiner Melodik
und krachenden Indierock-Wänden festhalten würden. Das Album
bekam beste Kritiken und konnte alle Trauer über das Ende von
Aerogramme lindern. Zwei Jahre später sind sie wieder da mit ihrer
unwiderstehlichen Kombination, vielleicht noch einen Tick leiser
geworden, aber das muss nicht überbewertet werden. Mal leise
versponnen, mal ansteigend überlagert bietet auch das zweite Album
der Schotten ein sehr schön abwechslungsreiches Wechselbad der
Gefühle.
Mit
Aerogramme hatten sie sich einen Namen gemacht, nach Stimmproblemen und
damit verbundenen Veränderungen in Gesang und Musik war eine
Umbenennung eine radikale, aber nachvollziehbare Konsequenz. Bereits
auf ihrem ersten Album unter „Unwinding Hours“-Banner
hatten Iain Cook und Craig B bewiesen, dass sie an der
grundsätzlichen, spannungsgeladenen Mischung aus feiner Melodik
und krachenden Indierock-Wänden festhalten würden. Das Album
bekam beste Kritiken und konnte alle Trauer über das Ende von
Aerogramme lindern. Zwei Jahre später sind sie wieder da mit ihrer
unwiderstehlichen Kombination, vielleicht noch einen Tick leiser
geworden, aber das muss nicht überbewertet werden. Mal leise
versponnen, mal ansteigend überlagert bietet auch das zweite Album
der Schotten ein sehr schön abwechslungsreiches Wechselbad der
Gefühle. Für KW 29: Gaslight Anthem - Handwritten (Mercury)
 Im
Rock kann man auf verschiedene Art Erfolg haben. Der einfachste –
und leider zugleich schwerste – ist, mit der ersten Single einen
Superhit zu landen und danach Narrenfreiheit zu haben – von der
Plattenfirma und dem Nachschub-hungrigen Fanvolk gleichermaßen.
Ein zweiter ist der stete Tropfen, der den Stein hölt,
jahrelange Aufbauarbeit über unermüdliches Live-Spielen und
durchgemachte Nächte in Demokellern, Selbstbaustudios, am PC und
Telefon – die meiste Zeit mit leerem Portemonnaie und Magen. Ein
dritter – von vielen weiteren – aber sehr Erfolg
versprechender ist, sich eine Nische, ein
(mehr-oder-weniger-)Extremgenre mit treuer Fanbase zu suchen, sich hier
durch kompromissloses Auftreten ein großes Maß an
Authentizität, Credibility und Fans zu sichern und dann
plötzlich auf Basis dieser (vergleichsweise kurzen) Vorarbeit im
richtigen Moment den Absprung zum Major(label) zu schaffen. Wenn das
dann folgende Album ein paar der alten Tugenden mit einem
massenkompatiblen Ansatz verbindet, kann auch nicht mehr viel
schiefgehen.
Im
Rock kann man auf verschiedene Art Erfolg haben. Der einfachste –
und leider zugleich schwerste – ist, mit der ersten Single einen
Superhit zu landen und danach Narrenfreiheit zu haben – von der
Plattenfirma und dem Nachschub-hungrigen Fanvolk gleichermaßen.
Ein zweiter ist der stete Tropfen, der den Stein hölt,
jahrelange Aufbauarbeit über unermüdliches Live-Spielen und
durchgemachte Nächte in Demokellern, Selbstbaustudios, am PC und
Telefon – die meiste Zeit mit leerem Portemonnaie und Magen. Ein
dritter – von vielen weiteren – aber sehr Erfolg
versprechender ist, sich eine Nische, ein
(mehr-oder-weniger-)Extremgenre mit treuer Fanbase zu suchen, sich hier
durch kompromissloses Auftreten ein großes Maß an
Authentizität, Credibility und Fans zu sichern und dann
plötzlich auf Basis dieser (vergleichsweise kurzen) Vorarbeit im
richtigen Moment den Absprung zum Major(label) zu schaffen. Wenn das
dann folgende Album ein paar der alten Tugenden mit einem
massenkompatiblen Ansatz verbindet, kann auch nicht mehr viel
schiefgehen.
The Gaslight Anthem aus New Brunswick versuchen‘s auf diesem Weg,
haben sich zunächst mit 2½ Alben im Punk / Indie /
Alternative-Rock einen Namen gemacht und schlenzen jetzt eine
butterweiche Manni-Kaltz-Ecke direkt ins Tor. Da wird manch alter Fan
verwundert das Resthaar kratzen, die meisten werden sich über
supereingängige Hooklines freuen, über Songs zwischen
Matchbox Twenty, Live und Bruce Springsteen, angeführt von der
herrlich rauen Stimme Brian Fallons zwischen Kings of Leon und Jimmy
Barnes. Dass das nur noch am Rande mit ihren Anfangstagen zu tun hat,
stört angesichts der o.g. Qualitäten kaum – und
könnte – dank Narrenfreiheit und wenn sie nicht
Nickelback-mäßig erfolgsverwöhnt werden – mit dem
nächsten Album ja auch schon wieder ganz anders werden….
Wir sind gespannt!
Für KW 28: Peter Gabriel – Secret World Live (Eagle Vision)
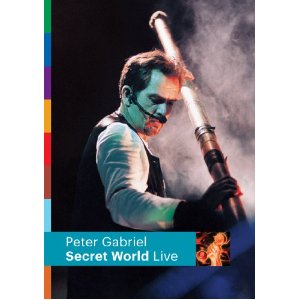 Die
Live-Versionen seiner ´93er-Tour haben längst Kultstatus:
Was für eine bombastische Show, was für fantastische
Versionen von Songs, wie „Shaking the Trees“, „Secret
World“ oder „In your Eyes“ (die allesamt allein in
diesen Versionen längst Kultstatus haben) und was für geniale
Showeffekte in Songs wie „Come talk to me“, „San
Jacinto“ oder „Digging in the Dirt“. Das
Gesamtkunstwerk konnte den Briten als Ausnahmekünstler etablieren
– und ist eine erneuten Betrachtung wert. Eagle Vision hat sich
die Aufnahmen nach zwanzig Jahren noch einmal vorgenommen, sie poliert,
remixed und remastered. Ein Stück Art-Pop-Geschichte! (Eagle)
Die
Live-Versionen seiner ´93er-Tour haben längst Kultstatus:
Was für eine bombastische Show, was für fantastische
Versionen von Songs, wie „Shaking the Trees“, „Secret
World“ oder „In your Eyes“ (die allesamt allein in
diesen Versionen längst Kultstatus haben) und was für geniale
Showeffekte in Songs wie „Come talk to me“, „San
Jacinto“ oder „Digging in the Dirt“. Das
Gesamtkunstwerk konnte den Briten als Ausnahmekünstler etablieren
– und ist eine erneuten Betrachtung wert. Eagle Vision hat sich
die Aufnahmen nach zwanzig Jahren noch einmal vorgenommen, sie poliert,
remixed und remastered. Ein Stück Art-Pop-Geschichte! (Eagle)
Für KW 27: Tiemo Hauer – Für den Moment (green elephant)
 Sein
Name tauchte zu selben Zeit auf - und erschein doch nicht ganz oben in
den Schlagzeilen. Der ganz große Kelch ging im letzten Jahr noch
an ihm vorüber, während seine Kollegen Tim Bendzko,
Philip Poisel und Andreas Bourani mit ihren Hits im Rücken schon
voll durchstarteten. Aber auch Tiemo Hauer wird seinen Weg machen,
das beweist sein schneller, aber keinesfalls übereilter
Albumnachfolger. Beeindruckend schön und ungeheuer
abwechslungsreich – von Pop bis Rock, von Melancholie zu
überschäumender Freude. Grandios!
Sein
Name tauchte zu selben Zeit auf - und erschein doch nicht ganz oben in
den Schlagzeilen. Der ganz große Kelch ging im letzten Jahr noch
an ihm vorüber, während seine Kollegen Tim Bendzko,
Philip Poisel und Andreas Bourani mit ihren Hits im Rücken schon
voll durchstarteten. Aber auch Tiemo Hauer wird seinen Weg machen,
das beweist sein schneller, aber keinesfalls übereilter
Albumnachfolger. Beeindruckend schön und ungeheuer
abwechslungsreich – von Pop bis Rock, von Melancholie zu
überschäumender Freude. Grandios!
Für KW 26: Ordinary Brainwash - ME 2.0 (Metal Mind Production)
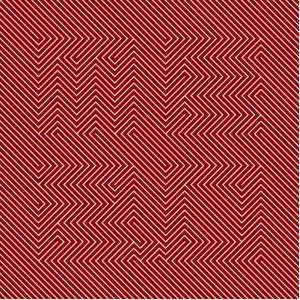 Und
noch ein One-Man-Projekt: Der polnische Multi-Instrumentalist,
Komponist und Produzent Rafal Zak hat hier eine faszinierende Mischung
aus Progressive und Alternative Rock – gerne auch als New Artrock
bezeichnet – aufgenommen. Mit musikalischen Parallelen zu Bands
wie Porcupine Tree, Chroma Key oder Gazpacho sowie der Tatsache, dass
er alles allein aufgenommen hat, kann man ihn am ehesten mit
Demian’s Nicolas Chapel vergleichen. Ähnlich
abwechslungsreich – und mitunter auch genauso gut – geht es
durch 8 Songs zwischen harten Gitarren und melancholischen Momenten.
Dabei deutet der Opener „Outdated“ schon an, wohin die
Reise geht, das erste Highlight ist dann Track 3
„Unbirthday“. Ein Track, der alle Fans der o.g. Bands
überzeugen dürfte. Auch das nachfolgende „Stay
Foolish“ ist grandios, aber auf andere Art,
„Homesick“ überzeugt durch seine melancholische,
atmosphärische Dichte und auch die beiden abschließenden
„Critical error“ und „Something Now“
glänzen auf ähnliche Weise. Vielleicht sind nicht alle Songs
von überragendem Format, richtige Ausfälle gibt es aber auch
nicht, von daher kann ich nur die Empfehlung aussprechen, hier mal
reinzuhören!
Und
noch ein One-Man-Projekt: Der polnische Multi-Instrumentalist,
Komponist und Produzent Rafal Zak hat hier eine faszinierende Mischung
aus Progressive und Alternative Rock – gerne auch als New Artrock
bezeichnet – aufgenommen. Mit musikalischen Parallelen zu Bands
wie Porcupine Tree, Chroma Key oder Gazpacho sowie der Tatsache, dass
er alles allein aufgenommen hat, kann man ihn am ehesten mit
Demian’s Nicolas Chapel vergleichen. Ähnlich
abwechslungsreich – und mitunter auch genauso gut – geht es
durch 8 Songs zwischen harten Gitarren und melancholischen Momenten.
Dabei deutet der Opener „Outdated“ schon an, wohin die
Reise geht, das erste Highlight ist dann Track 3
„Unbirthday“. Ein Track, der alle Fans der o.g. Bands
überzeugen dürfte. Auch das nachfolgende „Stay
Foolish“ ist grandios, aber auf andere Art,
„Homesick“ überzeugt durch seine melancholische,
atmosphärische Dichte und auch die beiden abschließenden
„Critical error“ und „Something Now“
glänzen auf ähnliche Weise. Vielleicht sind nicht alle Songs
von überragendem Format, richtige Ausfälle gibt es aber auch
nicht, von daher kann ich nur die Empfehlung aussprechen, hier mal
reinzuhören!
Für KW 25: Docker's Guild - The Mystic Technocracy (Lion Music)
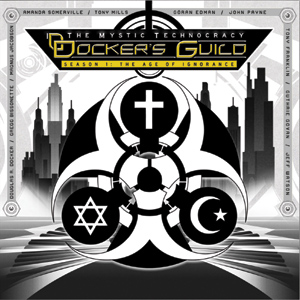 So
kann man ein Ein-Mann-Projekt spannend machen: R. Docker wandelt mit
der Gästeliste – und der Idee einer ganzen Reihe von
sukzessiven Konzeptalben (in diesem Fall ist eine Quintologie
geplahnt!) – auf den Spuren Arjen Lucassens. Sein Debütalbum
präsentiert Musiker wie Gregg Bissonette (David Lee Roth /
Joe Satriani), Magnus Jacobson (Miss Behavior), Tony Franklin (Blue
Murder), Guthrie Govan (Asia) und Jeff Watson (Night Ranger) sowie u.a.
die Gastsänger John Payne (Asia), Göran Edman (Karmakanic)
und Amanda Somerville (Avantasia / Epica). Und auch musikalisch
ist’s nicht meilenweit entfernt – man höre nur Epics
wie “Judeo Christian Cosmogony”. Aber es ist weniger
metallisch, sondern weist v.a. Parallelen zu Asia und ELP auf –
bombastische Choral-artige Instrumentalpassagen, große
Chöre, fette Drums und Keyboards (Produktion Simon Hanhart (Asia,
Marillion, Arena))! Die Musiker kommen zwar Zum Großteil aus dem
AOR-Setting, Docker ist aber detailverliebter und setzt das ganze auch
deutlich progressiver um – da bahnt sich etwas Großes an!
Auch die Story ist kein Kindergeburtstag – aber das war wohl auch
bei einem 5-Album-Projekt nicht anders zu erwarten. Es geht um den
Religionswahn von Christen, Juden und Moslems – fortgedacht in
einem Setting in der Zukunft. Fett, fett, fett!
So
kann man ein Ein-Mann-Projekt spannend machen: R. Docker wandelt mit
der Gästeliste – und der Idee einer ganzen Reihe von
sukzessiven Konzeptalben (in diesem Fall ist eine Quintologie
geplahnt!) – auf den Spuren Arjen Lucassens. Sein Debütalbum
präsentiert Musiker wie Gregg Bissonette (David Lee Roth /
Joe Satriani), Magnus Jacobson (Miss Behavior), Tony Franklin (Blue
Murder), Guthrie Govan (Asia) und Jeff Watson (Night Ranger) sowie u.a.
die Gastsänger John Payne (Asia), Göran Edman (Karmakanic)
und Amanda Somerville (Avantasia / Epica). Und auch musikalisch
ist’s nicht meilenweit entfernt – man höre nur Epics
wie “Judeo Christian Cosmogony”. Aber es ist weniger
metallisch, sondern weist v.a. Parallelen zu Asia und ELP auf –
bombastische Choral-artige Instrumentalpassagen, große
Chöre, fette Drums und Keyboards (Produktion Simon Hanhart (Asia,
Marillion, Arena))! Die Musiker kommen zwar Zum Großteil aus dem
AOR-Setting, Docker ist aber detailverliebter und setzt das ganze auch
deutlich progressiver um – da bahnt sich etwas Großes an!
Auch die Story ist kein Kindergeburtstag – aber das war wohl auch
bei einem 5-Album-Projekt nicht anders zu erwarten. Es geht um den
Religionswahn von Christen, Juden und Moslems – fortgedacht in
einem Setting in der Zukunft. Fett, fett, fett!
Für KW 24: Rush - Clockwork Angels (Roadrunner)
 Sie
sind ein klangliches Unikat! Auch auf ihrem zwanzigsten (!) Studioalbum
klingen sie – ungeachtet aller Feinkorrekturen, die sie immer
wieder mal vorgenommen haben – noch immer genauso
ursprünglich Rush-mäßig wie seit gefühlten 120
Jahren. Wobei ich mich aber frage, ob ich mich über die
Jahrtausende langsam an den Sound gewöhnt habe und mich
„warmgehört“ habe, oder ob sie tatsächlich eine
qualitative Steigerung vollzogen haben. Schon ihre letzten
Veröffentlichungen hatten immer wieder echte Knallersongs an Bord.
Und genauso gibt es auch 2012 wieder Meilensteine – vom Opener
„Caravan“ über das Titelstück bis zum melodischen
„The Wreckers“. Und auch dazwischen gehören die drei
7-Minüter "The Anarchist”, "The Garden" und mit
Abstrichen auch "Headlong Flight" zur Topliga der Rush-Songs.
Über Produktion und Können der Kanadier muss an dieser Stelle
ohnehin nicht diskutiert werden – dieses Album wird keinen Fan
enttäuschen.
Sie
sind ein klangliches Unikat! Auch auf ihrem zwanzigsten (!) Studioalbum
klingen sie – ungeachtet aller Feinkorrekturen, die sie immer
wieder mal vorgenommen haben – noch immer genauso
ursprünglich Rush-mäßig wie seit gefühlten 120
Jahren. Wobei ich mich aber frage, ob ich mich über die
Jahrtausende langsam an den Sound gewöhnt habe und mich
„warmgehört“ habe, oder ob sie tatsächlich eine
qualitative Steigerung vollzogen haben. Schon ihre letzten
Veröffentlichungen hatten immer wieder echte Knallersongs an Bord.
Und genauso gibt es auch 2012 wieder Meilensteine – vom Opener
„Caravan“ über das Titelstück bis zum melodischen
„The Wreckers“. Und auch dazwischen gehören die drei
7-Minüter "The Anarchist”, "The Garden" und mit
Abstrichen auch "Headlong Flight" zur Topliga der Rush-Songs.
Über Produktion und Können der Kanadier muss an dieser Stelle
ohnehin nicht diskutiert werden – dieses Album wird keinen Fan
enttäuschen.
Trotzdem muss konsterniert werden, dass ihre Songs trotz aller Melodik
immer eine latente Hektik ausstrahlen, die nach
übermäßigem Genuss schon eine fühlbare Steigerung
des Adrenalinspiegels und der Herzfrequenz bis zur Kurzatmigkeit mit
sich ziehen kann. Anders ausgedrückt: So genial die Stücke
für sich sind, mehr als ein halbes Rush-Album am Stück muss
nicht unbedingt sein. Oder geht nur mir das so?
Für KW 23: Petter Carlsen – Clocks don’t count (Function / Cargo)
 Ben Howard, Dan Mangan, … mit Petter Carlsen steht schon
wieder ein neuer Name auf der Liste der interessanten
Singer/Songwriter-(mehr-oder-weniger-)Newcomer. Der Norweger hat
bereits einen Namen in seiner Heimat, sein Debütalbum „You
go Bird“ erschien 2009 und das vorliegende „Clocks
don’t count“ erschien in Norwegen auch bereits vor einem
Jahr. Jetzt kommen wir in den Genuss! Das Besondere an Petter Carlsen
ist nicht nur seine Stimme und der Abwechslungsreichtum seiner Songs.
Da reicht die Palette von ganz ruhigen, melancholischen Songs bis zu
schnelleren Arrangements an der Grenze zum Rock, von der einfachen
Instrumentierung bis zum großen Epik-Arrangement. Es sind auch
die feinen Details, die das Album interessant machen.
Überraschenden Harmonien, Klangfolgen und Wendungen in seinen
Songs. Nicht in allen, wir sprechen hier ja nicht von Progressivrock,
sondern von generell einfach konsumierbarem Pop. Gerade so viel, dass
auch der Musikkenner gerne genauer hinhört und mit der Zunge
schnalzt.
Ben Howard, Dan Mangan, … mit Petter Carlsen steht schon
wieder ein neuer Name auf der Liste der interessanten
Singer/Songwriter-(mehr-oder-weniger-)Newcomer. Der Norweger hat
bereits einen Namen in seiner Heimat, sein Debütalbum „You
go Bird“ erschien 2009 und das vorliegende „Clocks
don’t count“ erschien in Norwegen auch bereits vor einem
Jahr. Jetzt kommen wir in den Genuss! Das Besondere an Petter Carlsen
ist nicht nur seine Stimme und der Abwechslungsreichtum seiner Songs.
Da reicht die Palette von ganz ruhigen, melancholischen Songs bis zu
schnelleren Arrangements an der Grenze zum Rock, von der einfachen
Instrumentierung bis zum großen Epik-Arrangement. Es sind auch
die feinen Details, die das Album interessant machen.
Überraschenden Harmonien, Klangfolgen und Wendungen in seinen
Songs. Nicht in allen, wir sprechen hier ja nicht von Progressivrock,
sondern von generell einfach konsumierbarem Pop. Gerade so viel, dass
auch der Musikkenner gerne genauer hinhört und mit der Zunge
schnalzt.
Für KW 22: Marillion - Best. Live (Madfish/Edel)
 Während
sie eigentlich
gerade auf ihre neue Studioveröffentlichung aufmerksam machen,
für die sie die Aufnahmen gerade abgeschlossen haben und die noch
in diesem Jahr erscheinen soll, bringen sie zwischendurch mal
eben ein neues Live-Album auf den Markt. Auch ein Weg, seinen
Namen in Umlauf zu halten. Und wie der Titel sagt, ist es eine
bunte Mischung aus allen Schaffensphasen der Band. Da kommt sogar
ein Triple wie Hotel Hobbies / Warm Wet Circles / That time of the
Night
endlich zu (späten!) offiziellen CD-Ehren. Es bleibt gleichzeitig
die einzige Reminiszenz an die Ära der Band als Fish noch
Frontmann der Band war. Raritäten wie „The
Release“ und Favoriten wie „The Invisible Man“,
„King“, „Neverland“ und „Man Of A
Thousand Faces“ machen das Ganze schon zum wertigen Package.
Allerdings bleibt bei einer Auswahl aus Aufnahmen von 2003 – 2010
zwangsläufig die Frage nach der Zielgruppe… aber
darüber muss ich mir ja glücklicherweise keine Gedanken
machen: Das könnt ihr selbst entscheiden!
Während
sie eigentlich
gerade auf ihre neue Studioveröffentlichung aufmerksam machen,
für die sie die Aufnahmen gerade abgeschlossen haben und die noch
in diesem Jahr erscheinen soll, bringen sie zwischendurch mal
eben ein neues Live-Album auf den Markt. Auch ein Weg, seinen
Namen in Umlauf zu halten. Und wie der Titel sagt, ist es eine
bunte Mischung aus allen Schaffensphasen der Band. Da kommt sogar
ein Triple wie Hotel Hobbies / Warm Wet Circles / That time of the
Night
endlich zu (späten!) offiziellen CD-Ehren. Es bleibt gleichzeitig
die einzige Reminiszenz an die Ära der Band als Fish noch
Frontmann der Band war. Raritäten wie „The
Release“ und Favoriten wie „The Invisible Man“,
„King“, „Neverland“ und „Man Of A
Thousand Faces“ machen das Ganze schon zum wertigen Package.
Allerdings bleibt bei einer Auswahl aus Aufnahmen von 2003 – 2010
zwangsläufig die Frage nach der Zielgruppe… aber
darüber muss ich mir ja glücklicherweise keine Gedanken
machen: Das könnt ihr selbst entscheiden!
Für KW 21: Kopek – White Collar Lies (Another Century/EMI)
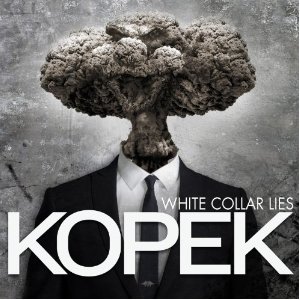 Super!
„Indie“-Rock mit bemerkenswert prägnanten Melodien,
der zwischendurch fast Pop-Affinität aufweist, der aber nicht
zuletzt durch die raue Rockröhre Daniel Jordans immer kernig
bleibt. Da ergeben sich durchaus klangliche Parallelen zu den Kings of
Leon oder Stereophonics. Die Dubliner sind als Trio gestartet,
mittlerweile sind sie nur noch 2 – auch das macht diese Band
besonders. Unverständlich ist, dass das Album bei uns mit einiger
Verzögerung erst jetzt erscheint, nachdem es in der Heimat bereits
seit über einem Jahr für Furore gesorgt hat. Da bleibt zu
hoffen, dass sie die "Festland-Veröffentlichung" mit ausgiebigem
Touren begleiten... (geht das als Duo?). Es bleibt spannend!...
Super!
„Indie“-Rock mit bemerkenswert prägnanten Melodien,
der zwischendurch fast Pop-Affinität aufweist, der aber nicht
zuletzt durch die raue Rockröhre Daniel Jordans immer kernig
bleibt. Da ergeben sich durchaus klangliche Parallelen zu den Kings of
Leon oder Stereophonics. Die Dubliner sind als Trio gestartet,
mittlerweile sind sie nur noch 2 – auch das macht diese Band
besonders. Unverständlich ist, dass das Album bei uns mit einiger
Verzögerung erst jetzt erscheint, nachdem es in der Heimat bereits
seit über einem Jahr für Furore gesorgt hat. Da bleibt zu
hoffen, dass sie die "Festland-Veröffentlichung" mit ausgiebigem
Touren begleiten... (geht das als Duo?). Es bleibt spannend!...
Für KW 20: Affector - Harmagedon (InsideOut/EMI)
 Ist das der endgültige Todesstoß für Enchant? 2003
erschien ihr letztes Studioalbum, "Tug of war", von Ted Leonard war
wiederholt von Plänen für ein Soloalbum zu lesen bis zuletzt bekannt wurde,
dass er Nick D`Virgilio bei Spocks Beard am Mikro ersetzen würde... alles noch
Projekte, die man neben Enchant verstanden hätte. Aber nun kommen mit Affector
eine weitere neue Band mit Ted Leonard am Mikro und mit einem Album zwischen
höchst versiertem Instrumental-Gefrickel und Enchant-Pop-Prog. Exzellenter
Prog-Metal, für Prog-Fans immer interessant genug und qualitativ hochwertig,
für mehr melodieverliebte Enchant-Fans mit genügend Konzentration auf Hooklines
und Melodie. Und v.a. mit tollem Gesangspart, mit fantastischer Gitarrenarbeit,
sehr sehr fein! Das könnte jetzt fast als Enchant-Ersatz durchgehen. Aber ein
versichernder Blick auf ihre Seite verrät: Enchant arbeiten am neuen
Album! Braucht's noch mehr gute
Meldungen?
Ist das der endgültige Todesstoß für Enchant? 2003
erschien ihr letztes Studioalbum, "Tug of war", von Ted Leonard war
wiederholt von Plänen für ein Soloalbum zu lesen bis zuletzt bekannt wurde,
dass er Nick D`Virgilio bei Spocks Beard am Mikro ersetzen würde... alles noch
Projekte, die man neben Enchant verstanden hätte. Aber nun kommen mit Affector
eine weitere neue Band mit Ted Leonard am Mikro und mit einem Album zwischen
höchst versiertem Instrumental-Gefrickel und Enchant-Pop-Prog. Exzellenter
Prog-Metal, für Prog-Fans immer interessant genug und qualitativ hochwertig,
für mehr melodieverliebte Enchant-Fans mit genügend Konzentration auf Hooklines
und Melodie. Und v.a. mit tollem Gesangspart, mit fantastischer Gitarrenarbeit,
sehr sehr fein! Das könnte jetzt fast als Enchant-Ersatz durchgehen. Aber ein
versichernder Blick auf ihre Seite verrät: Enchant arbeiten am neuen
Album! Braucht's noch mehr gute
Meldungen?
Für KW 19: Agent Fresco - A Long Time Listening (Agent Fresco / Rocket Gorl / RTD)
 Wer
hat‘s erfunden? Dredg? And you will know us by the Trail of Dead?
Keine Ahnung, wahrscheinlich die Kombination aus diversen Bands und
Konstellationen. Tatsache ist, dass es einst undenkbar schien, dass
konträre Genres zueinander finden würden. Ich erinnere mich
an manches Kopfschütteln, als ich 2002 erklärte, neben der
„Progressive Rock Hour“, die ich seit 1997 bei Radio
Oldenburg 1 moderierte, jetzt auch meiner zweiten Passion, dem
Alternative Rock eine Sendung zu widmen („Blizzard“). Das
schien fast ähnlich blasphemisch wie die Tatsache, dass mein
Schwester seinerzeit neben (bzw. vorzugsweise alternativ) zur von Papa
geliebten Klassik auch auf Punk Konzerte ging. Geht nicht. Gibt’s
nicht. Heute gilt eher: Geht nicht gibt’s nicht!
Wer
hat‘s erfunden? Dredg? And you will know us by the Trail of Dead?
Keine Ahnung, wahrscheinlich die Kombination aus diversen Bands und
Konstellationen. Tatsache ist, dass es einst undenkbar schien, dass
konträre Genres zueinander finden würden. Ich erinnere mich
an manches Kopfschütteln, als ich 2002 erklärte, neben der
„Progressive Rock Hour“, die ich seit 1997 bei Radio
Oldenburg 1 moderierte, jetzt auch meiner zweiten Passion, dem
Alternative Rock eine Sendung zu widmen („Blizzard“). Das
schien fast ähnlich blasphemisch wie die Tatsache, dass mein
Schwester seinerzeit neben (bzw. vorzugsweise alternativ) zur von Papa
geliebten Klassik auch auf Punk Konzerte ging. Geht nicht. Gibt’s
nicht. Heute gilt eher: Geht nicht gibt’s nicht!
Die isländischen Agent Fresco sind, z.B., ein weiterer Vertreter
der längst nicht mehr verwundert bewunderten bzw.
kopfschüttelnd kommentierten Kombination aus Alternative und
Progressive Rock. Ihr Grundprinzip sind Songs. (Womit sie sich schon
mal von der klassischen Prog-Band unterscheiden… .) Gute Songs
dazu! Die auch gerne mal etwas (modern) härter ausfallen
dürfen, die Gitarren mal etwas scheppern lassen, den Gesang in
extremere Gefilde aufsteigen lassen (das wird zumindest angedeutet,
nicht schlimm, keine Panik!). Die aber hier und da auch gerne mal etwas
komplexer ausfallen dürfen, hier eine Spielerei, da ein Break, ein
Taktwechsel, etwas Unerwartetes. Das ist, was ich unter dem
progressiven Element in ihrer Musik verstehe. Nichts Verschwurbeltes,
nichts verdrehtes, keine endlosen Instrumentalpassagen. Dafür sind
sie viel zu Songbasiert. Aber abwechslungsreich, komplex und
anspruchsvoll. Groß! Echt. Kann ich empfehlen!
Für KW 18: Gregor Meyle – Meile für Meyle (Meylemusic/tonpool)
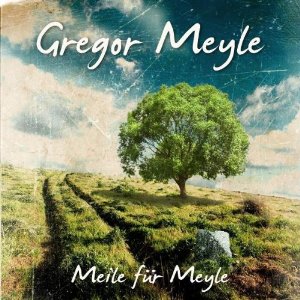 Er
ist längst kein Geheimtipp mehr. Seine Umtriebigkeit – v.a.
in Sachen Musik – bringt ihm ständig neue Freunde. Mitunter
auch prominente – was sich in Edo Zankis Covern eines seiner
Songs beweist genauso wie die Einladung zur Teilnahme am Sampler der
SWR Big Band gemeinsam mit Künstlern wie Xavier Naidoo oder Llaith
Al-Deen. Oder die Zusammenarbeit mit Produzent Christian Lohr, der sich
als Fan outete und unbedingt Platz in seinem international besetzten
Terminplan machen wollte. Das Ergebnis liegt jetzt vor mit Meyles
Studioalbum #3. Im liebgewonnenen Stil und in alter Klasse, mit toller
Stimme und schönen Songs. Dabei sind „laute“ Songs wie
„Steh wieder auf!“ und ganz viele leise Momente, neue
„Klassiker“ wie „Dann bin ich zuhaus“ und der
Big Band-Beitrag „Wunder“. Das sorgt für Abwechslung
und Kurzweil. Aber Vorsicht Gregor: Beim Meylenabreißen den Blick
fürs Besondere, das Detail und die Schönheit der Abwechslung
nicht verlieren!
Er
ist längst kein Geheimtipp mehr. Seine Umtriebigkeit – v.a.
in Sachen Musik – bringt ihm ständig neue Freunde. Mitunter
auch prominente – was sich in Edo Zankis Covern eines seiner
Songs beweist genauso wie die Einladung zur Teilnahme am Sampler der
SWR Big Band gemeinsam mit Künstlern wie Xavier Naidoo oder Llaith
Al-Deen. Oder die Zusammenarbeit mit Produzent Christian Lohr, der sich
als Fan outete und unbedingt Platz in seinem international besetzten
Terminplan machen wollte. Das Ergebnis liegt jetzt vor mit Meyles
Studioalbum #3. Im liebgewonnenen Stil und in alter Klasse, mit toller
Stimme und schönen Songs. Dabei sind „laute“ Songs wie
„Steh wieder auf!“ und ganz viele leise Momente, neue
„Klassiker“ wie „Dann bin ich zuhaus“ und der
Big Band-Beitrag „Wunder“. Das sorgt für Abwechslung
und Kurzweil. Aber Vorsicht Gregor: Beim Meylenabreißen den Blick
fürs Besondere, das Detail und die Schönheit der Abwechslung
nicht verlieren!
Für KW 17: Peter Gabriel - Live Blood (2CD Eagle Records)
 Erst
waren es nur ein paar Konzerte, dann wurde die Tour erweitert, wurde
live in diverse Kinos übertragen, dann auf DVD veröffentlicht
– und jetzt gibt’s das Ganze auch nochmal als CD. Eine
Entwicklung, die so kaum absehbar war- für Gabriel aber
wahrscheinlich der beste Grund, nicht mit Fragen nach einem neuen Album
genervt zu werden. Das wird ohnehin dauern. Die vorliegenden Versionen
seiner Songs sind „neu“ genug: Immerhin sind sie nicht nur
mit Orchester erweitert, sondern kommen komplett ohne
„Rockband“ aus, d.h. ohne Drums, ohne Gitarre. Über
die Qualität dieser Fassungen ist an anderer Stelle bereits
ausführlich gesprochen worden – wer es immer noch nicht
gehört hat, der sollte sich das spätestens mit dieser Fassung
des kompletten Londoner Konzertes gönnen!
Erst
waren es nur ein paar Konzerte, dann wurde die Tour erweitert, wurde
live in diverse Kinos übertragen, dann auf DVD veröffentlicht
– und jetzt gibt’s das Ganze auch nochmal als CD. Eine
Entwicklung, die so kaum absehbar war- für Gabriel aber
wahrscheinlich der beste Grund, nicht mit Fragen nach einem neuen Album
genervt zu werden. Das wird ohnehin dauern. Die vorliegenden Versionen
seiner Songs sind „neu“ genug: Immerhin sind sie nicht nur
mit Orchester erweitert, sondern kommen komplett ohne
„Rockband“ aus, d.h. ohne Drums, ohne Gitarre. Über
die Qualität dieser Fassungen ist an anderer Stelle bereits
ausführlich gesprochen worden – wer es immer noch nicht
gehört hat, der sollte sich das spätestens mit dieser Fassung
des kompletten Londoner Konzertes gönnen!
Für KW 16: Anathema - Weather Systems (Kscope/Edel)
 Gibt
es das perfekte Album? Wahrscheinlich ohnehin immer nur temporär
und weil es mehr oder weniger individuell und subjektiv mit den exakt
richtigen Harmonien oder Textzeilen oder Stimmungen ins Schwarze
trifft. Das habe ich auch schon früher erlebt, aber das trifft auf
dieses Album einmal mehr ausnahmslos zu.
Gibt
es das perfekte Album? Wahrscheinlich ohnehin immer nur temporär
und weil es mehr oder weniger individuell und subjektiv mit den exakt
richtigen Harmonien oder Textzeilen oder Stimmungen ins Schwarze
trifft. Das habe ich auch schon früher erlebt, aber das trifft auf
dieses Album einmal mehr ausnahmslos zu.
Bereits ihr 2010er „We're here because we're here”-Album
ließ den geneigten Fan in Erfurcht erstarren: Ursprünglich
mal im Doom gestartet, ging es über Metal und Prog zum
sphärischen New Artrock mit pompösen Pink
Floyd-meets-Porcupine-Tree-Sounds. Ein Jahr später taten sie mit
„Falling deeper“ einen Schritt seitwärts, nahmen
verschiedene ihrer eigenen Klassiker orchestral neu auf und gaben sich
eher mystisch und verträumt, ohne in neue Ebenen
vorzustoßen. Und jetzt sind sie zurück. Haben ihre Energien
und Stärken gebündelt und setzen ihrem orchestralen
Rock-Sound die Krone auf. Sie verzaubern mit akustischen Gitarren vor
Breitwandepik, bauen wiederholt atemberaubende Steigerungen ein, in
denen auch die härteren Gitarren schließlich mit einsteigen
dürfen, sie brillieren mit genialem Duettgesang und bauen
schließlich mit einer glasklaren Bombastproduktion jedes Paar
Kopfhörer zum Ganzkörperfön um – oder wie sind die
gefühlten ca. 5 Millionen aufgestellten Haare (so viele hat man
laut google) sonst zu erklären? Meine erste Reaktion auf dieses
Album war, dass ich mir kaum vorstellen konnte, dass es 2012 irgendwie
noch besser werden kann als mit diesem Album! Mittlerweile, hab ich
auch noch ein paar weitere neue Alben gehört (u.a. Sinew, stun,
...) und weiß, dass dieses Jahr einfach nur musikalisch verdammt
gut zu werden verspricht!
Für KW 15: Ancestors - In Dreams And Time (Tee Pee / Rough Trade)
 Was
für ein Brett!!! Fetter, tiefer, schwerer – Prog goes
Psychedelic goes Stoner. Keyboards, elegische Gitarrensoli, tiefer
Gesang. Die Kalifornier schwelgen mit ihrem Sound in den tiefsten
70ern zwischen Crimson, Floyd und Purple, transportieren das
Ganze mit flirrenden Electronic-Beigaben auch gern mal ins neue
Jahrtausend und machen damit Bands wie Anathema Konkurrenz und nehmen
zwischendurch noch das Düstere von Neurosis mit...
whooooaaaaaarrrrr! "In Dreams And Time" ist das dritte Album und
dürfte einige Fans in unseren Breiten finden - nicht nur unter
Fans von Bands wie Opeth, Anathema, Riverside.
Was
für ein Brett!!! Fetter, tiefer, schwerer – Prog goes
Psychedelic goes Stoner. Keyboards, elegische Gitarrensoli, tiefer
Gesang. Die Kalifornier schwelgen mit ihrem Sound in den tiefsten
70ern zwischen Crimson, Floyd und Purple, transportieren das
Ganze mit flirrenden Electronic-Beigaben auch gern mal ins neue
Jahrtausend und machen damit Bands wie Anathema Konkurrenz und nehmen
zwischendurch noch das Düstere von Neurosis mit...
whooooaaaaaarrrrr! "In Dreams And Time" ist das dritte Album und
dürfte einige Fans in unseren Breiten finden - nicht nur unter
Fans von Bands wie Opeth, Anathema, Riverside.
Für KW 14: Everlaunch - Number One (Me.Inyou Records / Soulfood)
 Wie
ergänzt man die in lästiger Permanenz wiederkehrenden
Placebo-Vergleiche durch neue Namen? Ungewöhnliche dazu? Zum
Beispiel, indem man durch die dramatischen „Sultans of
Swing“-Licks in „Get into Panic“ an Dire Straits
erinnert und das folgende „Fray your Senses“ cool mit dem
„Brothers in Arms“-Riffs beginnt… da sind wir doch
schon wo, oder? Das mag an der eigentlichen Zielgruppe (wahrscheinlich
glücklicherweise) vorbeigehen, ist aber nur einer von vielen
Belegen dafür, dass die Rotenburger bemüht sind, ihr
Soundspektrum zu erweitern. Und in der Tat gibt es kaum noch
überdeutliche Placebo-Parallelen (abgesehen vom Opener
„World on Fire“ und „Masquerade“ vielleicht).
Stattdessen regiert gepflegter Indie-Rock mit manch guter Idee und
vielen guten Hooklines, der aber nicht ganz an die Glanzleistung des
Debütalbums heranreichen kann. Aber das ist schon ok, mit diesem
Urteil müssen die meisten Zweitwerke leben.
Wie
ergänzt man die in lästiger Permanenz wiederkehrenden
Placebo-Vergleiche durch neue Namen? Ungewöhnliche dazu? Zum
Beispiel, indem man durch die dramatischen „Sultans of
Swing“-Licks in „Get into Panic“ an Dire Straits
erinnert und das folgende „Fray your Senses“ cool mit dem
„Brothers in Arms“-Riffs beginnt… da sind wir doch
schon wo, oder? Das mag an der eigentlichen Zielgruppe (wahrscheinlich
glücklicherweise) vorbeigehen, ist aber nur einer von vielen
Belegen dafür, dass die Rotenburger bemüht sind, ihr
Soundspektrum zu erweitern. Und in der Tat gibt es kaum noch
überdeutliche Placebo-Parallelen (abgesehen vom Opener
„World on Fire“ und „Masquerade“ vielleicht).
Stattdessen regiert gepflegter Indie-Rock mit manch guter Idee und
vielen guten Hooklines, der aber nicht ganz an die Glanzleistung des
Debütalbums heranreichen kann. Aber das ist schon ok, mit diesem
Urteil müssen die meisten Zweitwerke leben.
Extra: The Sunpilots - King of the Sugartongued Tongues (Honeytrap / RTD)
 Diese
Jungs erinnern mich irgendwie an Sylvan – nicht zuletzt wegen der
Stimme ihres australischen Sängers Raj Siva-Rajah. Womit man
dieses Album auch als Handschuh in Richtung Sylvan geworfen ansehen
kann! Die Sunpilots sind eine australisch-deutsche Kooperation und
präsentieren eine spannende und mitreißende Mischung aus
Alt. und Art Rock und melodischen Prog-Elementen. Und der Zeitpunkt
für diesen Handschuh-Wurf könnte kaum günstiger
gewählt sein: just als sich die Hamburger Art-Rock-Könige
Sylvan mit „Sceneries“ so richtig auf ihrem Thron
einkuscheln und wohnlich einrichten wollten, mit ihrem aktuellen
Doppelalbum zwar alle Register gezogen, aber innovativ nichts Neues
aufgetischt haben, bläst dieser Gegenwind umso effektiver. An der
o.g. Mischung ist schon absehbar, dass die Sunpilots deutlich rockiger
und wesentlich weniger episch sind (vgl. The Intersphere!), aber genau
das ist die Stärke dieses Albums.
Diese
Jungs erinnern mich irgendwie an Sylvan – nicht zuletzt wegen der
Stimme ihres australischen Sängers Raj Siva-Rajah. Womit man
dieses Album auch als Handschuh in Richtung Sylvan geworfen ansehen
kann! Die Sunpilots sind eine australisch-deutsche Kooperation und
präsentieren eine spannende und mitreißende Mischung aus
Alt. und Art Rock und melodischen Prog-Elementen. Und der Zeitpunkt
für diesen Handschuh-Wurf könnte kaum günstiger
gewählt sein: just als sich die Hamburger Art-Rock-Könige
Sylvan mit „Sceneries“ so richtig auf ihrem Thron
einkuscheln und wohnlich einrichten wollten, mit ihrem aktuellen
Doppelalbum zwar alle Register gezogen, aber innovativ nichts Neues
aufgetischt haben, bläst dieser Gegenwind umso effektiver. An der
o.g. Mischung ist schon absehbar, dass die Sunpilots deutlich rockiger
und wesentlich weniger episch sind (vgl. The Intersphere!), aber genau
das ist die Stärke dieses Albums.
„King Of The Sugarcoated Tongues“ ist bereits ihr zweites
Album, und schon ihr Debüt wurde 2008 in Australien als
„Indie Album of the Year“ ausgezeichnet… das sollte
ich mir jetzt wohl als nächstes anhören! Ihr neues Werk ist
ein Konzeptalbum, das in acht Kapiteln die Geschichte einer
dystopischen Zukunft erzählt, deren Gesellschaft zusammengebrochen
ist. Grob gesagt, geht es um das menschliche Bedürfnis nach
Sicherheit und die Freiheiten, die wir bereit sind dafür
aufzugeben. Veröffentlicht am 27.4. wird die Geschichte bereits
seit dem 2. März kapitelweise als kostenfreier Download
veröffentlicht, bis am 27. April das gesamte Album als
kostenfreier Download angeboten wird. Über G-Records/Rough Trade
wird 'King Of The Sugarcoated Tongues' zudem als Digpack vertrieben.
Für KW 13: Steve Hogarth Richard Barbieri - Not The Weapon But The Hand (kScope)
 Mehr
Marillion oder mehr “h”, mehr Porcupine Tree oder mehr
Japan, das ist hier die Frage. Natürlich werden die Fans aller
dieser Bands aufmerksam, bei diesem Doppel – aber wer die
bisherigen Soloergüsse von „h“ kennt, weiß auch,
dass sie nur bedingt etwas mit der Musik seiner Band zu tun haben.
Elektronischer, sphärischer und viel, viel ruhiger, noch mehr
Dominanz der Stimme und den Rockfaktor ganz nach hinten geschoben, das
ist, was man von ihm kennengelernt hat. Daran gemessen gibt es auf
diesem Album schon erstaunlich viel Rhythmik. Songs wie „Red
Kite“ und „Only Love will make you free“ (mit
interessanter Stimmfarbenveränderung von Hogarth) sind echte
Highlights, „Crack“ gibt sich direkt tanzbar! Der Einfluss
von Richard Barbieri? In einem Song erscheint er sogar auch als
Sänger. Aber letztendlich ist es natürlich die
Schnittmenge von „h“ und Japan (und deren
Barbiere-begleitete „Ablegern“), die hier
stimmungsmäßig tonangebend ist. Da sollte man also auch
schon mal auf Rhythmusinstrumente verzichten können. Aber die
Songs sind es wert!
Mehr
Marillion oder mehr “h”, mehr Porcupine Tree oder mehr
Japan, das ist hier die Frage. Natürlich werden die Fans aller
dieser Bands aufmerksam, bei diesem Doppel – aber wer die
bisherigen Soloergüsse von „h“ kennt, weiß auch,
dass sie nur bedingt etwas mit der Musik seiner Band zu tun haben.
Elektronischer, sphärischer und viel, viel ruhiger, noch mehr
Dominanz der Stimme und den Rockfaktor ganz nach hinten geschoben, das
ist, was man von ihm kennengelernt hat. Daran gemessen gibt es auf
diesem Album schon erstaunlich viel Rhythmik. Songs wie „Red
Kite“ und „Only Love will make you free“ (mit
interessanter Stimmfarbenveränderung von Hogarth) sind echte
Highlights, „Crack“ gibt sich direkt tanzbar! Der Einfluss
von Richard Barbieri? In einem Song erscheint er sogar auch als
Sänger. Aber letztendlich ist es natürlich die
Schnittmenge von „h“ und Japan (und deren
Barbiere-begleitete „Ablegern“), die hier
stimmungsmäßig tonangebend ist. Da sollte man also auch
schon mal auf Rhythmusinstrumente verzichten können. Aber die
Songs sind es wert!
Ein aktuelles Interview mit Steve Hogarth gibt es HIER!
Für KW 12: Dan Mangan - Oh Fortune (City Slang)
 Das sind diese Alben, die diesen Job so liebenswert machen.
Auf einen Herrn wie diesen kommt doch (so schnell) sonst niemand. Nicht dass
sich das schleunigst ändern sollte, das wird nach Hören dieser CD klar, aber
wer weiß, wie weit Ideal und Realität hier wieder voneinander entfernt sind. Dan
Mangan kommt aus Kanada und „Oh Fortune“ ist bereits sein drittes Album – und bis
auf ein begeisterten Haufen Zuschauer im Spiegelzelt des Haldern Festivals, die
eine „Sternstunde der Rockmusik“ (laut) erlebten, scheinen sich seine
Qualitäten bislang noch nicht herumgesprochen zu haben. Dan Mangan ist in bester
Singer-/Songwriter-Tradition beheimatet, seine Songs haben aber fast immer den
gewissen Extra-Twist. Oft relativ ruhig, aber immer wieder auch mit rockigen
Ausbrüchen, immer wieder mit netten Effekten & Sounds, schön
abwechslungsreich, mit guter Stimme ausgestattet... da erinnert eine Menge
(positiv) an Ryan Adams. Sehr schön! (ror)
Das sind diese Alben, die diesen Job so liebenswert machen.
Auf einen Herrn wie diesen kommt doch (so schnell) sonst niemand. Nicht dass
sich das schleunigst ändern sollte, das wird nach Hören dieser CD klar, aber
wer weiß, wie weit Ideal und Realität hier wieder voneinander entfernt sind. Dan
Mangan kommt aus Kanada und „Oh Fortune“ ist bereits sein drittes Album – und bis
auf ein begeisterten Haufen Zuschauer im Spiegelzelt des Haldern Festivals, die
eine „Sternstunde der Rockmusik“ (laut) erlebten, scheinen sich seine
Qualitäten bislang noch nicht herumgesprochen zu haben. Dan Mangan ist in bester
Singer-/Songwriter-Tradition beheimatet, seine Songs haben aber fast immer den
gewissen Extra-Twist. Oft relativ ruhig, aber immer wieder auch mit rockigen
Ausbrüchen, immer wieder mit netten Effekten & Sounds, schön
abwechslungsreich, mit guter Stimme ausgestattet... da erinnert eine Menge
(positiv) an Ryan Adams. Sehr schön! (ror)
Für KW 11: Flying Colors - Flying Colors (Mascot / RTD)
 Das
Allstar-Projekt um Mike Portnoy (dr, voc), Neal Morse (key, voc) und
Steve Morse (Deep Purple, git). Letzterer hat aus seiner Dixie
Dregs-Vergangenheit auch gleich noch Dave LaRue (bs) mitgebracht,
zusätzlich gibt es mit Casey McPerson (voc, git) einen "Neuen" in
diesem Kreis. Vorgeschlagen von Mike Portnoy kommt er von der Band
Alpha Rev, die 2010 mit ihrem Debütalbum „New Morning“
in den USA einige Erfolge verbuchen konnten; er singt hier ein wenig
mehr noch als Neal Morse, womit dem eine ungewohnt zurückhaltende
Position am Mikro beschieden ist.
Das
Allstar-Projekt um Mike Portnoy (dr, voc), Neal Morse (key, voc) und
Steve Morse (Deep Purple, git). Letzterer hat aus seiner Dixie
Dregs-Vergangenheit auch gleich noch Dave LaRue (bs) mitgebracht,
zusätzlich gibt es mit Casey McPerson (voc, git) einen "Neuen" in
diesem Kreis. Vorgeschlagen von Mike Portnoy kommt er von der Band
Alpha Rev, die 2010 mit ihrem Debütalbum „New Morning“
in den USA einige Erfolge verbuchen konnten; er singt hier ein wenig
mehr noch als Neal Morse, womit dem eine ungewohnt zurückhaltende
Position am Mikro beschieden ist.
So, wisst ihr nun alles? Ach so, noch etwas zur Musik. Was soll denn da
noch schiefgehen, bei diesem Quintett? In der Tat ist das hier
technisch natürlich auf höchstem Niveau, musikalisch aber
dennoch oft überraschend. Das Ganze ist mal wieder mehr als die
Summe seiner Teile… im durchaus positiven Sinn! Das Album
startet mit einem Siebenminüter in bester
„90s-Genesis“-Tradition, sehr schwungvoll und nicht
unbedingt, was man einem konkreten Mitglied dieser Band zuschreiben
könnte; direkte Vergleiche sind hier – wie auf dem Rest des
Albums – ohnehin schwer. Mit vielen Highlights und oft
überraschend geht es quer durchs Album. Manches klingt fast nach
AOR, zwischendurch jammt eine Bluesgitarre, am Ende wird’s doch
noch Progmetallisch genauso wie balladesk und den Abschluss macht ein
herrliches 12-Minuten Epic… man könnte natürlich viel,
viel mehr sagen zu den Songs, aber nötig ist’s nicht: Wer
die (bzw. ein paar der) Akteure kennt, kann sich vorstellen, worauf er
sich einlässt – und er wird dieses Abenteuer nicht bedauern.
Nuff said. Viel Spaß beim Hören! (prr)
Für KW 10: Gazpacho - March Of Ghosts (Kscope)
 „March
of Ghosts“ entstand in der Hochstimmung des Londoner Konzertes
und im direkten Anschluss daran, der Großteil davon wurde
innerhalb einer exzessiven 24-Stunden-Jamsession von Jon-Arne, Mikael
und Thomas komponiert. Trotzdem ist dies alles andere als ein
Schnellschuss! Viel mehr hört man dem Album eine Energie an, die
sie zurück in die Rockspur trägt – genial! Zwar war
auch schon „Missa Atropos” in der Hinsicht ein Volltreffer
(und eigentlich nicht nur in dieser Hinsicht…), aber ich glaube,
die Norweger schaffen es zum dritten Mal in Folge, das jeweils beste
neue Album ihrer Karriere vorzulegen!
„March
of Ghosts“ entstand in der Hochstimmung des Londoner Konzertes
und im direkten Anschluss daran, der Großteil davon wurde
innerhalb einer exzessiven 24-Stunden-Jamsession von Jon-Arne, Mikael
und Thomas komponiert. Trotzdem ist dies alles andere als ein
Schnellschuss! Viel mehr hört man dem Album eine Energie an, die
sie zurück in die Rockspur trägt – genial! Zwar war
auch schon „Missa Atropos” in der Hinsicht ein Volltreffer
(und eigentlich nicht nur in dieser Hinsicht…), aber ich glaube,
die Norweger schaffen es zum dritten Mal in Folge, das jeweils beste
neue Album ihrer Karriere vorzulegen!
Nach zwei Konzeptalben geht es 2012 übrigens mehr um eine Sammlung
von Kurzgeschichten, die allerdings auch vom gemeinsamen Thema getragen
werden: Die Idee war, dass die Hauptperson in einer Nacht all diese
Geister trifft (tot und lebendig), die ihm ihre Geschichten
erzählen. Geister von Haitianischen Kriegsverbrechern, von der
Crew der Marie Celeste, eines Amerikanischen Soldaten des 1.
Weltkrieges, der sich im Jahre 2012 wiederfindet und eines englischen
Comedians, der des Hochverrats angeklagt wurde und sich seit dem die
Aufnahmen seiner Sendungen auf Enemy Radio anhört.
Kurzgeschichten, die die vorbeiziehenden Geister erzählen und die
erzählt werden müssen, findet Sänger Jan-Henrik. (Ein
klasse Album, findet prr)
Für KW 9: Rauschenberger - Alles fließt (Very Us Records)
 Ein
Album, für das diese Rubrik hier erfunden wurde, weil es ein Album
sein wird, dem wohl nicht die Aufmerksamkeit zuteil werden wird, die es
verdient. Dabei ist die erste Single „Hannover, nicht
Hollywood“ (in seinen B-Seiten wahlweise auch Bremen, Hamburg
oder Köln; eine nette Idee!) nicht nur richtig gut, sondern auch
sehr radiokompatibel. Wie es das ganze Album nicht viel weniger ist.
Eine gekonnte Mischung aus handgemachtem Pop und Rock, garniert mit
wahlweise gekonnten Steigerungen, symphonischen oder auch fragilen
Momenten. Dazu Texte, die Spaß machen, ihnen zuzuhören. Das
ist das männliche Silbermond-Pendant, gegründet auf den
musikalischen Britpop-Ideen der Jeremy Days oder Oasis. Zwischenurch
klingts wie bei Gregor Meyle oder Stefan Gwildis. Oder so
ähnlich. Hört mal rein! (rkr)
Ein
Album, für das diese Rubrik hier erfunden wurde, weil es ein Album
sein wird, dem wohl nicht die Aufmerksamkeit zuteil werden wird, die es
verdient. Dabei ist die erste Single „Hannover, nicht
Hollywood“ (in seinen B-Seiten wahlweise auch Bremen, Hamburg
oder Köln; eine nette Idee!) nicht nur richtig gut, sondern auch
sehr radiokompatibel. Wie es das ganze Album nicht viel weniger ist.
Eine gekonnte Mischung aus handgemachtem Pop und Rock, garniert mit
wahlweise gekonnten Steigerungen, symphonischen oder auch fragilen
Momenten. Dazu Texte, die Spaß machen, ihnen zuzuhören. Das
ist das männliche Silbermond-Pendant, gegründet auf den
musikalischen Britpop-Ideen der Jeremy Days oder Oasis. Zwischenurch
klingts wie bei Gregor Meyle oder Stefan Gwildis. Oder so
ähnlich. Hört mal rein! (rkr)
Für KW 8: Ben Howard – Every Kingdom (Island)
 Atemberaubend!
Vom ersten, zaghaften Zupfen der Akustischen im Opener „Old
Pine“ bis zum Nachhall des ausklingenden Gitarrenverstärkers
hat Howard hier ein Album erschaffen, dem man zuhören möchte.
Der intime Singer/Songwriter-Ansatz im Stiele eines David Gray oder Ben
Harper wird dabei erweitert durch Pop-Arrangements im Stile Fleetwood
Macs. Der 23jährige Brite zaubert auf seiner Gitarre nach, was die
Plattensammlung seiner Eltern mit Namen wie Mitchell, Dylan und Havens
ihm in die musikalische Wiege gelegt haben. Dabei macht er nichts, was
ein David Gray nicht auch machen könnte, aber er macht das sehr
gut! Und auf eine sehr erfrischende, unverbrauchte Art! (ror)
Atemberaubend!
Vom ersten, zaghaften Zupfen der Akustischen im Opener „Old
Pine“ bis zum Nachhall des ausklingenden Gitarrenverstärkers
hat Howard hier ein Album erschaffen, dem man zuhören möchte.
Der intime Singer/Songwriter-Ansatz im Stiele eines David Gray oder Ben
Harper wird dabei erweitert durch Pop-Arrangements im Stile Fleetwood
Macs. Der 23jährige Brite zaubert auf seiner Gitarre nach, was die
Plattensammlung seiner Eltern mit Namen wie Mitchell, Dylan und Havens
ihm in die musikalische Wiege gelegt haben. Dabei macht er nichts, was
ein David Gray nicht auch machen könnte, aber er macht das sehr
gut! Und auf eine sehr erfrischende, unverbrauchte Art! (ror)
Für KW 7: A Liquid Landscape - Nightingale Express (Glassville Records | Alive)
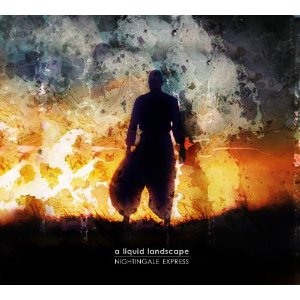 Wow,
das nenne ich mal eine fette Überraschung! Ein so kreatives
Stück Progrock aus Holland hab ich schon eine lange Weile nicht
mehr gehört… ich muss sagen, spontan fällt mir gerade
gar nichts Vergleichbares ein. Splinter sind (waren?) auch gut, aber
eine ganz andere Baustelle. A Liquid Landscape sind einfach wunderbar!
Das Album beginnt zunächst überhaupt nicht typisch proggy,
eher relativ straight, schlägt aber doch schnell eine
mitreißend melodische Enchant/Dredg/Karnivool-Richtung ein, womit
sie bei mir genau an der richtigen Adresse sind. Die Stimme, die
Gitarrenlicks, die oft melancholische Grundstimmung, die Dramatik, die
Breaks in oft ganz ruhige Gefilde, die herrlichen Instrumentalpassagen
– A Liquid Landscape sind ein ganz, ganz heißer Tipp! Das
haben ihre Landsleute übrigens auch schon gemerkt: Nach
Support-Slots für Tourneen von Karnivool, Anathema, Thrice oder
Riverside gehörte die Band zu den sechs Finalisten des letzten
Jahres beim prestigeträchtigen Dutch Grand Prize. (prr)
Wow,
das nenne ich mal eine fette Überraschung! Ein so kreatives
Stück Progrock aus Holland hab ich schon eine lange Weile nicht
mehr gehört… ich muss sagen, spontan fällt mir gerade
gar nichts Vergleichbares ein. Splinter sind (waren?) auch gut, aber
eine ganz andere Baustelle. A Liquid Landscape sind einfach wunderbar!
Das Album beginnt zunächst überhaupt nicht typisch proggy,
eher relativ straight, schlägt aber doch schnell eine
mitreißend melodische Enchant/Dredg/Karnivool-Richtung ein, womit
sie bei mir genau an der richtigen Adresse sind. Die Stimme, die
Gitarrenlicks, die oft melancholische Grundstimmung, die Dramatik, die
Breaks in oft ganz ruhige Gefilde, die herrlichen Instrumentalpassagen
– A Liquid Landscape sind ein ganz, ganz heißer Tipp! Das
haben ihre Landsleute übrigens auch schon gemerkt: Nach
Support-Slots für Tourneen von Karnivool, Anathema, Thrice oder
Riverside gehörte die Band zu den sechs Finalisten des letzten
Jahres beim prestigeträchtigen Dutch Grand Prize. (prr)
Für KW 6: Kettcar – Zwischen den Runden (Grand Hotel van Cleef / Indigo)
 Auf
den Newcomer-Überraschungsbonus, mit dem sie auf ihrem debüt
„Du und wie viel von deinen Freunden“ alle an die Wand
spielten, müssen sie mittlerweile verzichten – aber
dafür haben sie sich längst als eine der heißesten
Bands aus der Hansestadt im Indie-Rock/Pop etabliert. Ihr neues,
drittes Album kann entsprechend mit ganz anderen Qualitäten
aufwarten, ist abwechslungsreicher, erwachsener – und das sowohl
textlich als auch musikalisch. Vor allem in der ersten Hälfte der
CD kommen sie 2012 mit tollen Songs, danach fallen sie etwas
zurück in alte Schemata – aber ich glaube, dass kein Fan
ernsthaft etwas dagegen haben dürfte! Am Samstag, 28.2. sind sie
im Schlachthof, Bremen. (par)
Auf
den Newcomer-Überraschungsbonus, mit dem sie auf ihrem debüt
„Du und wie viel von deinen Freunden“ alle an die Wand
spielten, müssen sie mittlerweile verzichten – aber
dafür haben sie sich längst als eine der heißesten
Bands aus der Hansestadt im Indie-Rock/Pop etabliert. Ihr neues,
drittes Album kann entsprechend mit ganz anderen Qualitäten
aufwarten, ist abwechslungsreicher, erwachsener – und das sowohl
textlich als auch musikalisch. Vor allem in der ersten Hälfte der
CD kommen sie 2012 mit tollen Songs, danach fallen sie etwas
zurück in alte Schemata – aber ich glaube, dass kein Fan
ernsthaft etwas dagegen haben dürfte! Am Samstag, 28.2. sind sie
im Schlachthof, Bremen. (par)
Für KW 5: Van Halen – A Different Kind Of Truth (UID/ Interscope)
 Sie
haben es wirklich wahr gemacht: Nicht nur das erste Studioalbum seit
1998, das erste mit Originalsänger David Lee Roth seit 1984! Und
es rockt, als hätte es die 28 (!) Jahre nicht gegeben…
unglaublich! Ganz im Ernst hat man den Eindruck, dass sie absichtlich
die musikalischen Entwicklungen mit Mark II & III-Sänger Sammy
Hagar und Gary Cherone vergessen machen wollen und mit ihrem damaligen
Aushängeschild auch die alten Zeiten reaktivieren wollen. Ich
nehme an, dass sie live nicht einmal Songs der letzten 28 Jahr spielen.
Aber das ist ok, das können sie sich leisten. Sie hatten vor 1984
genügend und das neue Album bietet 13 neue Kracher in ihrem
klassischsten Hardrock-Stil. Keyboards und Pianoläufe?
Fehlanzeige! (Obwohl Zweitere strenggenommen ja mit „Jump“
bereits eingeführt wurden…) Balladen? Keine! Epics? No way.
Gerade einmal 4 der 13 Songs knacken die 4-Minuten-Marke. Sie wollen
noch nicht zum alten Eisen gehören und dieses Album beweist, dass
das auch niemand behaupten darf. Jetzt bitte die Live-Umsetzung…
und dann, Mr. Roth, wollen wir den Spagat sehen. Dann fallen auch die
Groupies wieder reihenweise auf die Knie. (rkr)
Sie
haben es wirklich wahr gemacht: Nicht nur das erste Studioalbum seit
1998, das erste mit Originalsänger David Lee Roth seit 1984! Und
es rockt, als hätte es die 28 (!) Jahre nicht gegeben…
unglaublich! Ganz im Ernst hat man den Eindruck, dass sie absichtlich
die musikalischen Entwicklungen mit Mark II & III-Sänger Sammy
Hagar und Gary Cherone vergessen machen wollen und mit ihrem damaligen
Aushängeschild auch die alten Zeiten reaktivieren wollen. Ich
nehme an, dass sie live nicht einmal Songs der letzten 28 Jahr spielen.
Aber das ist ok, das können sie sich leisten. Sie hatten vor 1984
genügend und das neue Album bietet 13 neue Kracher in ihrem
klassischsten Hardrock-Stil. Keyboards und Pianoläufe?
Fehlanzeige! (Obwohl Zweitere strenggenommen ja mit „Jump“
bereits eingeführt wurden…) Balladen? Keine! Epics? No way.
Gerade einmal 4 der 13 Songs knacken die 4-Minuten-Marke. Sie wollen
noch nicht zum alten Eisen gehören und dieses Album beweist, dass
das auch niemand behaupten darf. Jetzt bitte die Live-Umsetzung…
und dann, Mr. Roth, wollen wir den Spagat sehen. Dann fallen auch die
Groupies wieder reihenweise auf die Knie. (rkr)
Für KW 4: Arena - The Seventh Degree of Seperation (Verglas)
 Ich
möchte nicht von einer Rundumerneuerung sprechen, aber Arena
können nach sechs Jahren (Album-)Pause einige Veränderungen
vermelden. Das beginnt mit den personellen und endet mit den
musikalischen und dürfte einiges miteinander zu tun haben. Denn
die neue progressive Härte könnte man auch mit Verweis auf
z.B. Pendragon dem Zeitgeist zuschreiben, dürfte aber auch einfach
in der Stimmfarbe des neuen Frontmannes Paul Manzi begründet
liegen. Der hatte bereits mit Clive Nolan an dessen Rockoper
mitgearbeitet und passt im Prinzip wunderbar zu arena, deren
melodisch-progressive Grundausrichtung ja schon früher vereinzelt
durch gewisse AOR-Elemente erweitert wurde. Diese Tendenz wurde auf dem
neuen Album hier und da verstärkt, die Gitarren werden
gleichzeitig auch gerne mal etwas härter angeschlagen – das
passt schon ganz gut zusammen. Was anfangs noch etwas überraschend
klingt, relativiert sich im gesamtverlauf aber dann doch, denn immer
wieder gibt es die typischen Fettsound-Passagen, ausschweifende,
melodische Soli und entsprechender Bombast erlauben genügend
Referenzen an frühe Zeiten und Werke, so dass hier nur vermerkt
werden kann: Arena sind zurück, haben einiges aufgemöbelt und
poliert, sind aber im Kern immer noch die alten. Gar nicht schlecht! (prr)
Ich
möchte nicht von einer Rundumerneuerung sprechen, aber Arena
können nach sechs Jahren (Album-)Pause einige Veränderungen
vermelden. Das beginnt mit den personellen und endet mit den
musikalischen und dürfte einiges miteinander zu tun haben. Denn
die neue progressive Härte könnte man auch mit Verweis auf
z.B. Pendragon dem Zeitgeist zuschreiben, dürfte aber auch einfach
in der Stimmfarbe des neuen Frontmannes Paul Manzi begründet
liegen. Der hatte bereits mit Clive Nolan an dessen Rockoper
mitgearbeitet und passt im Prinzip wunderbar zu arena, deren
melodisch-progressive Grundausrichtung ja schon früher vereinzelt
durch gewisse AOR-Elemente erweitert wurde. Diese Tendenz wurde auf dem
neuen Album hier und da verstärkt, die Gitarren werden
gleichzeitig auch gerne mal etwas härter angeschlagen – das
passt schon ganz gut zusammen. Was anfangs noch etwas überraschend
klingt, relativiert sich im gesamtverlauf aber dann doch, denn immer
wieder gibt es die typischen Fettsound-Passagen, ausschweifende,
melodische Soli und entsprechender Bombast erlauben genügend
Referenzen an frühe Zeiten und Werke, so dass hier nur vermerkt
werden kann: Arena sind zurück, haben einiges aufgemöbelt und
poliert, sind aber im Kern immer noch die alten. Gar nicht schlecht! (prr)
Für KW 3: The
Intersphere - Hold on, Liberty! (Long Branch Records / SPV)
 Die Überflieger 2010 sind zurück mit einem neuen Album.
Genau zwei Jahre nach ihrem sensationellen Debütalbum wollen sie beweisen, dass
die erste Songsammlung kein Zufallstreffer war. Und so darf man sich freuen
über 11 neue Songs die alles besitzen, was einen Intersphere-Song ausmacht:
jede Menge Drive, intelligente Rhythmusarbeit, Hooklines, den einschmeichelnden
Gesang von Sänger Christoph Hessler, der die energetischen Rockgitarren genial
kontrastiert. Aufgenommen in nur sieben Tagen besitzen die Songs genau die gleiche
Dynamik, die diese Band auf ihrem Debüt schon so unwiderstehlich macht.
Trotzdem muss konstatiert werden, dass das zweite Album auch „nur“ exakt den
Weg weiterschreitet, den das Debüt eingeschlagen hat. Was zu einer Verlängerung
der Magie führt, um mal den alten Cake-Albumtitel zu zitieren, was aber
langfristig in einer Sackgasse enden könnte. Aber so weit wollen wir noch gar
nicht denken. Hier sind sie, bereit für die nächsten 350 Gigs um ihre
musikalische Mission in die Tat umzusetzen. Und wir dürfen daran teilhaben, ist
das nicht wunderbar? (prr)
Die Überflieger 2010 sind zurück mit einem neuen Album.
Genau zwei Jahre nach ihrem sensationellen Debütalbum wollen sie beweisen, dass
die erste Songsammlung kein Zufallstreffer war. Und so darf man sich freuen
über 11 neue Songs die alles besitzen, was einen Intersphere-Song ausmacht:
jede Menge Drive, intelligente Rhythmusarbeit, Hooklines, den einschmeichelnden
Gesang von Sänger Christoph Hessler, der die energetischen Rockgitarren genial
kontrastiert. Aufgenommen in nur sieben Tagen besitzen die Songs genau die gleiche
Dynamik, die diese Band auf ihrem Debüt schon so unwiderstehlich macht.
Trotzdem muss konstatiert werden, dass das zweite Album auch „nur“ exakt den
Weg weiterschreitet, den das Debüt eingeschlagen hat. Was zu einer Verlängerung
der Magie führt, um mal den alten Cake-Albumtitel zu zitieren, was aber
langfristig in einer Sackgasse enden könnte. Aber so weit wollen wir noch gar
nicht denken. Hier sind sie, bereit für die nächsten 350 Gigs um ihre
musikalische Mission in die Tat umzusetzen. Und wir dürfen daran teilhaben, ist
das nicht wunderbar? (prr)
Für KW 2: Dirk Darmstaedter’s Me and Cassity – Appearances (Tapete)
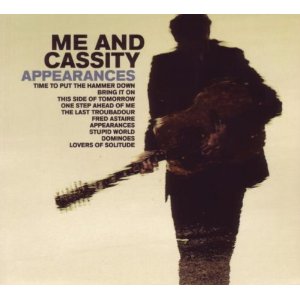 Als
Kind der 80er – rein musiksozialisationstechnisch, meine ich
– bin ich natürlich an den Jeremy Days nicht vorbei
gekommen. Ihre Sternstunden auf der Live-Bühne hab ich zwar leider
verpasst – dabei waren sie sogar mal auf dem Oldenburger
Kultursommer, aber da war ich im Urlaub – meine damalige
Tapetausch-Leidenschaft konnte mich aber auf ihre Großtaten
aufmerksam machen. Als ich sie dann endlich mal gesehen haben, waren
sie schon relativ brav geworden, kurz später trennten sie sich. Es
dauerte eine Weile, bis ich Dirk wieder wahrnahm – d.h.,
eigentlich hat er mich selbst drauf gebracht, als ich ihn bei einem
Lloyd Cole Konzert in der Fabrik in Hamburg getroffen habe. Und
natürlich hat er eine fantastische Stimme, schreibt immer wieder
grandiose Songs aber vieles von dem, das er seit 1998 solo
veröffentlicht hat, war mir etwas zu überwiegend ruhig
– nein, v.a. zu spartanisch. Immer wieder gab es Ansätze
für, bzw. einzelne Songs im Bandsound. Den hat er jetzt auf seinem
neuen Album wieder vermehrt ausgepackt – und kehrt damit
zurück auf dem Pfad des großen Pop – mit mehr
Abwechslung und reicher instrumentierten Arrangements als auf seinen
letzten Soloalben. Und mit tollen Songs. Und spätestens wenn er
mit „Stupid World“ und „Lovers of Solitude“ zur
Axt greift, wie es die einschlägigen Medien nennen würden,
fallen alle Ansätze zur Zurückhaltung in sich zusammen.
Grandios! (rkr)
Als
Kind der 80er – rein musiksozialisationstechnisch, meine ich
– bin ich natürlich an den Jeremy Days nicht vorbei
gekommen. Ihre Sternstunden auf der Live-Bühne hab ich zwar leider
verpasst – dabei waren sie sogar mal auf dem Oldenburger
Kultursommer, aber da war ich im Urlaub – meine damalige
Tapetausch-Leidenschaft konnte mich aber auf ihre Großtaten
aufmerksam machen. Als ich sie dann endlich mal gesehen haben, waren
sie schon relativ brav geworden, kurz später trennten sie sich. Es
dauerte eine Weile, bis ich Dirk wieder wahrnahm – d.h.,
eigentlich hat er mich selbst drauf gebracht, als ich ihn bei einem
Lloyd Cole Konzert in der Fabrik in Hamburg getroffen habe. Und
natürlich hat er eine fantastische Stimme, schreibt immer wieder
grandiose Songs aber vieles von dem, das er seit 1998 solo
veröffentlicht hat, war mir etwas zu überwiegend ruhig
– nein, v.a. zu spartanisch. Immer wieder gab es Ansätze
für, bzw. einzelne Songs im Bandsound. Den hat er jetzt auf seinem
neuen Album wieder vermehrt ausgepackt – und kehrt damit
zurück auf dem Pfad des großen Pop – mit mehr
Abwechslung und reicher instrumentierten Arrangements als auf seinen
letzten Soloalben. Und mit tollen Songs. Und spätestens wenn er
mit „Stupid World“ und „Lovers of Solitude“ zur
Axt greift, wie es die einschlägigen Medien nennen würden,
fallen alle Ansätze zur Zurückhaltung in sich zusammen.
Grandios! (rkr)
2012: Für KW 1: Opeth – Heritage (Roadrunner)
 Bevor
wir in der nächsten Woche mit dem ersten Highlight 2012 beginnen,
schauen wir noch einmal kurz zurück auf ein Album, das hier noch
nicht aufgetaucht ist. Erst kamen Anathema mit einem Orchesteralbum,
fast komplett ohne Drums und großteils instrumental, dann
die Riverside-EP ohne Cookiemonster-Vocals, dann auch Opeth mit
dem melodischsten Album ihrer Karriere: Gibt es noch eine Zukunft
für den Death Metal? Werden sie plötzlich doch noch alle
vernünftig? Das ist sehr spannend, was Mikael Akerfeld (mit
Unterstützung von Steven Wilson) hier auftischt. Und so vertrackt,
wie die Songs sind, ist das hier lupenreiner ProgRock, an dem auch die
Hörer ihre Freude haben werden, die bislang mit Opeth noch nicht
so warm geworden sind. Was jetzt nicht heißen soll, dass das hier
nur noch Kindergeburtstag ist. Da werden durchaus schwere
Geschütze aufgefahren, nur mit Metal, geschweige denn Death Metal
hat das nichts mehr zu tun – und das ist ja das Gute. Wie
Akerfeldt es ausdrückt: „Es ist intensiv auf eine andere
Weise. Es fühlte sich für uns richtig an, ein Album wie
dieses jetzt aufzunehmen.“ Richtig! :-) (prr)
Bevor
wir in der nächsten Woche mit dem ersten Highlight 2012 beginnen,
schauen wir noch einmal kurz zurück auf ein Album, das hier noch
nicht aufgetaucht ist. Erst kamen Anathema mit einem Orchesteralbum,
fast komplett ohne Drums und großteils instrumental, dann
die Riverside-EP ohne Cookiemonster-Vocals, dann auch Opeth mit
dem melodischsten Album ihrer Karriere: Gibt es noch eine Zukunft
für den Death Metal? Werden sie plötzlich doch noch alle
vernünftig? Das ist sehr spannend, was Mikael Akerfeld (mit
Unterstützung von Steven Wilson) hier auftischt. Und so vertrackt,
wie die Songs sind, ist das hier lupenreiner ProgRock, an dem auch die
Hörer ihre Freude haben werden, die bislang mit Opeth noch nicht
so warm geworden sind. Was jetzt nicht heißen soll, dass das hier
nur noch Kindergeburtstag ist. Da werden durchaus schwere
Geschütze aufgefahren, nur mit Metal, geschweige denn Death Metal
hat das nichts mehr zu tun – und das ist ja das Gute. Wie
Akerfeldt es ausdrückt: „Es ist intensiv auf eine andere
Weise. Es fühlte sich für uns richtig an, ein Album wie
dieses jetzt aufzunehmen.“ Richtig! :-) (prr)